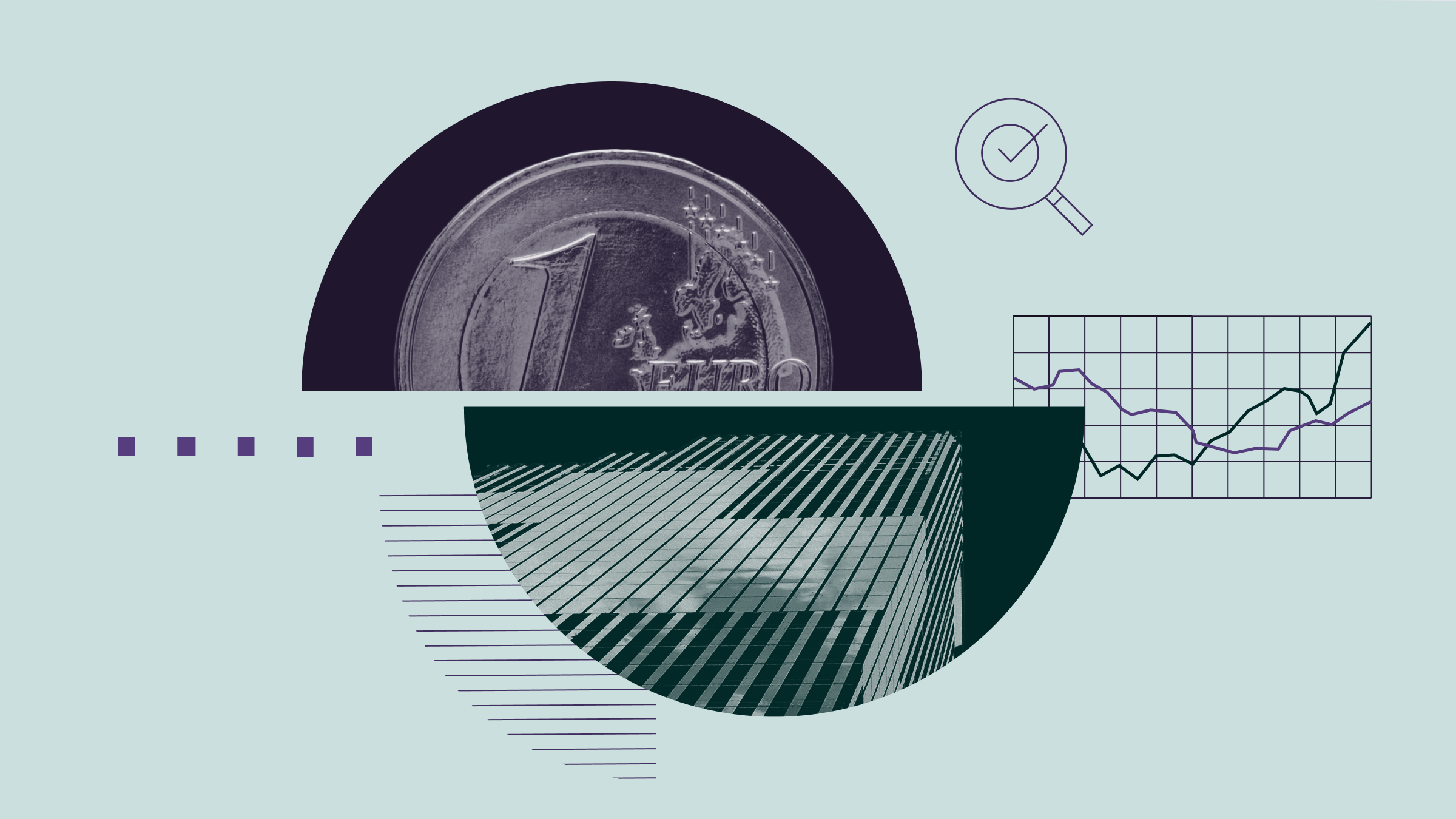Die allermeisten Lehrbücher und Abhandlungen zum Thema Investieren enthalten mindestens ein Kapitel über den Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite. Anlegern und Studenten wird darin im Schnelldurchgang erklärt, dass Rendite und Risiko in einem linearen Zusammenhang zueinander stehen: höhere erwartete Renditen kommen danach nur durch die Inkaufnahme höherer Risiken zustande. Der Großteil solcher Abhandlungen ist dann mathematisch geprägt und dreht sich um detaillierte Berechnungen zu diesem Zusammenhang auf der Grundlage von Preisveränderungen bei Wertpapieren.
Was ist es eigentlich, dieses Ding namens "Risiko"?
Sich dem Thema Risiko so zu nähern mag seine Berechtigung habe, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass diese Vorgehensweise nicht ausreicht, um die Risikowahrnehmung von Anlagern (und die Schlussfolgerungen dazu) ganzheitlich zu verstehen. Man muss tiefer bohren und sehr grundsätzliche Fragen stellen. Was ist eigentlich dieses „Risiko“, von dem immer die Rede ist? Es ist ganz sicher nicht identisch mit der Volatilität, also mit der Schwankungsintensität von Wertpapierkursen, auch wenn die Lehrbücher diese Annahme nach wie vor so treffen.
Ein gutes Beispiel für die Problematik, die Volatilität zum Maß aller Risikodinge zu erheben, sind offene Immobilienfonds: Lange Zeit schwankten deren Preise so gut wie überhaupt nicht. Dann kam die Immobilienkrise, und etliche dieser Fonds wurden geschlossen, das heißt, Anleger konnten ihre Anteile bei der Fondsgesellschaft nicht verkaufen, und der Fondspreis wurde eingefroren. Wer sich am Zweitmarkt von seinen Anteilen trennen wollte oder musste, verbuchte mit diesen „risikoarmen“ Papieren unter Umständen sehr hohe Verluste. Stabile Preisniveaus verringern rechnerisch die Standardabweichung, aber das Investment wird dadurch ganz bestimmt nicht sicherer. Im Zweifel ist es nur falsch bewertet.
Die Kritik an der Volatilität als Risikomaß ist nicht neu. In diesem Artikel gehe ich aber noch einen Schritt weiter und stelle die These auf, dass „Risiko“ viel mehr Dimensionen hat, als es der herkömmliche Begriff suggeriert. Der Begriff wird unnötig eng ausgelegt; Ich behaupte, dass sich die Renditen von Investments häufig aus ganz anderen Quellen speisen.
Wenn die Unbeliebtheit zur Hässlichkeit wird
Roger Ibbotson und mein Morningstar-Kollege Tom Idzorek vertreten in einem Aufsatz, der demnächst im Journal of Portfolio Management erscheinen wird, die Meinung, dass man das herkömmlich Risikospektrum (hoch-niedrig) durch das Konzept der „Beliebtheit“ bzw. „Popularität“ ersetzen sollte. Investoren sind bereit, bei populären Wertpapieren bescheidene Renditen in Kauf zu nehmen. Anders bei unbeliebten Wertpapieren. Sie müssen Kompensationen liefern, damit Investoren sie halten möchten.
Ich möchte das noch drastischer formulieren: Es geht nicht um die Frage „beliebt vs unbeliebt“, sondern um die Frage „attraktiv vs unattraktiv“. Wir bevorzugen eindeutig attraktive Tanzpartner, die wohltuend nach Veilchen duften, gegenüber den hässlichen, die die Aura einer Stinkmorchel verbreiten. Ich habe vier Quellen für unattraktive Investments ausgemacht. Die Verbesserung der Anlegerrenditen hängt davon ab, die darin enthaltenen Formen von Hässlichkeit zunächst zu identifizieren und dann in einem zweiten Schritt akzeptabel zu machen. Es geht also gewissermaßen um den Mut zur Stinkmorchel.
Die Vier Quellen der mangelnden Attraktivität (bzw. der Renditequellen) sind:
1) Ökonomische: Sie entspricht dem allgemeinen Verständnis von Anlagerisiko. Ein Wertpapier könnte weniger Rendite oder niedrigere Ausschüttungen liefern bzw. die Renditen könnten sich als weniger werthaltig entpuppen als erwartet. Wie Ibbotson und Idzorek schreiben, möchten Anleger für solche Quellen der Unattraktivität kompensiert werden.
2) Strukturelle: Hier geht es um die Frage, wie ein Wertpapier verpackt ist. Anlagen, die Steuervorteile bieten, günstig zu haben und einfach zu handeln sind (im Sinne von liquide) und Anleger fair behandeln (im Sinn von rechtlich günstig stellen) sind ansprechender als Papiere, die diese Eigenschaften nicht aufweisen. Roger Ibbotson hat ausgiebig über den Renditeaufschlag bzw. das Risiko illiquider Papiere geschrieben. Treffender wäre es, wenn man Illiquidität als unattraktive Struktur verstünde.
3) Restriktionen: Sie verhindern den Kauf bzw Besitz eines Wertpapiers. Anleger können aus verschiedenen Gründen durch Restriktionen zu gewissen Handlungen hingelenkt werden. Eine Ausprägung dieses Problem kann institutioneller Natur sein. Beispielsweise dürfen viele Institutionen die Aktien ihrer Wahl nicht hebeln. Die Folge ist, dass sie bei ihrer Jagd auf Rendite Aktien mit hoher Volatilität kaufen (und damit die künftigen Renditen drücken) und Aktien mit niedriger Volatilität links liegen lassen (und damit deren künftige Renditechancen erhöhen). Ein anderes Beispiel sind transnationale Handelsrestriktionen oder steuerliche Hürden. Diese Faktoren können die Renditen von Wertpapieren beeinflussen, werden aber gemeinhin nicht als Investment-Risiken angesehen.
4) Anlegerpsychologische (Behavioral) Gründe: Es ist schon viel darüber geschrieben worden, dass es Anlegern regelrecht Schmerzen verursacht, unbeliebte Wertpapiere zu kaufen bzw. zu halten. Diese Schmerzen sind aber typischerweise mit überdurchschnittlichen Renditen verbunden. Investoren können diese Quelle der Unbeliebtheit in ihrer Investment-Taktik berücksichtigen – und in bare Münze verwandeln.
Wir werden in den kommenden Wochen diese vier Renditequellen genauer überprüfen, sie auf ihre Operationalisierbarkeit im Rahmen von Investmentstrategien abklopfen und den Versuch wagen, die unterschiedlichen Strategien mit bestimmten Anlegerprofilen abzugleichen. Diese Reihe ist als Risikofragebogen der anderen Art zu verstehen. Hier geht es nicht darum die Frage zu beantworten, wie viel mehr Rendite sich mit wie viel mehr Volatilität erzielen lässt, sondern darum, dass Anleger unter Zuhilfnahme der Attraktivitäts-Typologien dazu kommen, die diversen Formen der Hässlichkeit als Teil ihrer Anlagestrategie akzeptieren zu lernen.