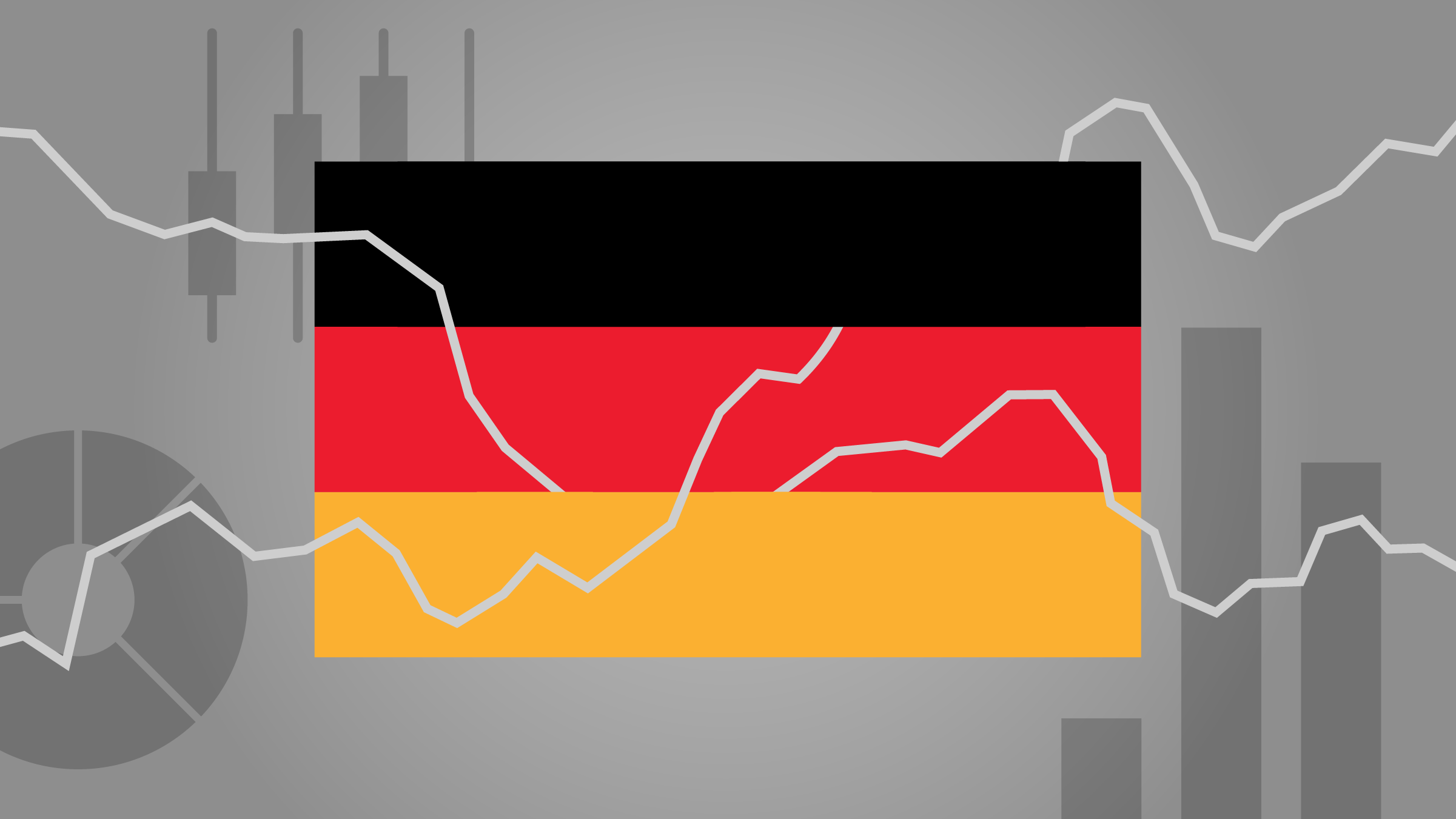Ebola, Flüchtlingsdramen, radikalislamischer Terror, politische Umstürze: Afrika wird heute ausschließlich mit den großen Katastrophen unserer Zeit in Verbindung gebracht. Doch das ist nur eine Seite der Medaille. Die großen volkswirtschaftlichen Wachstumsgeschichten finden zugleich in Afrika statt, und das spiegelt sich auch in den Aktienkursen wider. Seit Herbst 2011 hat der MSCI Nigeria um 33% zugelegt, der MSCI Kenia sogar um 57%. Pro Jahr, versteht sich. Zeit also, einen Kontrapunkt zu den Elendsgeschichten zu setzen und die immer noch glänzende Seite der Medaille zu zeigen. Wir sprachen mit Carlos von Hardenberg, Emerging Markets-Spezialist bei Franklin Templeton und Co-Manager der Fonds Templeton Africa und Templeton Frontier Markets, über Afrika-Investments. Er brachte am Rande des Gesprächs auch einen weiteren Aspekt ins Spiel. Auf die Frage, ob man heute angesichts der Krisen und Katastrophen überhaupt in Afrika investieren solle, kam die Antwort wie aus der Pistole geschossen: "Auf die Krisen Afrikas mit Geldabzug zu reagieren, wäre das falscheste, was man machen könnte!".
Herr von Hardenberg: Die grassierende Ebola-Seuche, politische Instabilität in Ostafrika, Regimewechsel in Nordafrika. Lauern in Afrika heute nicht mehr Gefahren für Investoren als das sich Chancen verbergen?
Carlos von Hardenberg: Nein, das sehe ich nicht so, auch wenn das anhand der Nachrichtenlage vielleicht erstaunen mag. Man muss sehen, wo Afrika vor 40, 50 Jahren stand. Es hat sich in den letzten zwei Dekaden unheimlich viel getan – sei es in Sachen Transparenz, politischer Stabilität oder wirtschaftlicher Entwicklung. Viele afrikanische Staaten haben nach ihrer Unabhängigkeit in den 1950-er und 1960er Jahren unglaublich turbulente Zeiten durchlebt, in vielen Staaten hat der ständige Wechsel zwischen den verschiedenen Militärjuntas und anderen korrupten Regimen das Wirtschaftsleben gelähmt. Vor diesem Hintergrund kommt man zu einer wohlwollenderen Bewertung der Lage heute. Die staatlichen Institutionen haben sich in vielen Ländern verfestigt, Demokratiebewegungen haben eine Chance. Dazu haben Fortschritte in der Informationstechnologie und die Verbreitung der sozialen Medien einen wichtigen Beitrag geleistet. Informationen gelangen schnell in abgelegene Regionen, und Missstände kommen heute schneller zutage, was wiederum die Machthaber diszipliniert.
Wie übersetzt sich dieses neue Paradigma auf die Unternehmensebene?
Zunächst haben sich die Transparenz der Unternehmen und damit der Zugang ausländischer Investoren zu Informationen sehr stark verbessert. Man bemüht sich um ausländische Anleger, weil man erkannt hat, dass es ohne sie nicht geht. Wer Eigenkapitalgeber braucht, muss transparent sein, seine Geschäftszahlen pünktlich und zuverlässig veröffentlichen, Geschäftsberichte übersetzen und testieren lassen und so weiter. Dass hat sich sehr schnell herumgesprochen, und immer mehr Unternehmen orientieren sich an anderen erfolgreichen Vorbildern.
Wie würden Sie die Ebola-Epidemie einordnen? Ist das nicht eine Bedrohung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in weiten Teilen Westafrikas?
Es hat in der Vergangenheit immer wieder extreme Ereignisse gegeben, die man nicht hat kommen sehen und die den Lauf der Menschheitsgeschichte verändert haben. Ist das jetzt wieder der Fall? Man kann das heute nicht abschätzen. Ich muss mich am Hier und Jetzt orientieren. Fakt ist, dass wir bisher noch sehr weit entfernt vom Eintritt der düsteren Szenarien sind. Es sterben alleine in Westafrika etwa 1.000 Mal so viele Menschen an Malaria pro Jahr wie bisher an Ebola gestorben sind. In manchen Städten kommen im Straßenverkehr in einem Monat mehr Menschen ums Leben als bisher in ganz Afrika an Ebola gestorben sind. Ich will nichts beschönigen oder relativieren, aber die Lage ist nicht außer Kontrolle. Die Reaktion der Regierung von Sierra Leone kam prompt. Man versucht Ordnung herzustellen, und man hat sich sehr schnell und deutlich mit Hilfegesuchen an das Ausland gewendet. Inzwischen sind die Hilfsaktionen der westlichen Nationen angelaufen.
Und wie sieht es auf Ebene der Unternehmen aus, die Sie im Templeton Afrika oder auch im Templeton Frontier Fonds halten, mussten Sie wegen Ebola reagieren?
Nein, wir sehen bisher wegen der Ebola-Epidemie keinen Handlungsbedarf. Wir haben in Sierra Leone kein Exposure. Im Senegal haben wir in die Telekomfirma Sonatel investiert, die in verschiedenen Ländern tätig ist – auch in den vom Ebola-Virus betroffenen. Sonatel geht es nach wie vor gut, und ich sehe keinen Grund, warum sich das ändern sollte. Die Menschen werden immer telefonieren. Mit wenigen Ausnahmen sind die Geschäftsmodelle der Unternehmen, mit denen wir in Westafrika zusammenarbeiten, noch nicht nachhaltig betroffen. Es findet nach wie vor Handel statt, Rohstoffe werden exportiert. Das gilt sogar für Sierra Leone. Die zuletzt veröffentlichten Zahlen zeigen einen Rekordexport bei Eisenerz. Wir sehen zwar schon Folgen, aber Einschränkungen beim Reiseverkehr, der vor allem Expat-Manager und Experten betrifft. Das ist nicht existenziell für die Firmen. Es kann natürlich sein, dass bei einer Verschlimmerung der Lage auch Teile der Geschäfte dort zum erliegen kommen. Aber was soll die Konsequenz aus dieser Gefahrenlage sein: Sollen wir den betroffenen Ländern den Rücken kehren und desinvestieren? Das wäre meines Erachtens eine ganz falsche Schlussfolgerung.
Vielleicht ergeben sich ja auch durch die unklare Gemengelage Chancen? Die Märkte tendieren bekanntlich zu Überreaktionen.
Bisher sehen wir keine Überreaktion. Die Investoren waren bisher ziemlich rational. Der Handel läuft normal, und wenn Sie sich Kurse der großen Unternehmen vor Ort ansehen, dann werden Sie feststellen, dass es bisher kaum zu einer Reaktion kam.
Dennoch waren die Renditen von Afrika-Investments in den vergangenen Jahren eher bescheiden. Schaut man sich die größeren paneuropäischen Aktienindizes oder den S&P 500 in den USA an, dann könnte man zur Schlussfolgerung gelangen, dass langweilige europäische oder amerikanische Blue Chips die bessere Wahl sind ein Abenteuer am afrikanischen Aktienmarkt. So ein bisschen fühle ich mich an die Boom-Story China erinnert. Dort hat sich das starke Wirtschaftswachstum nicht in Überrenditen für den Westlichen Investor übersetzt.
Das Problem bei den Afrika-Indizes ist, dass sie sehr Südafrika-lastig sind und deshalb unter den extrem negativen Währungseffekten der vergangenen Jahre gelitten haben. Der südafrikanische Rand war eine der schwächsten Währungen weltweit. Außerdem ist der Aktienmarkt dort von Rohstoff-Konzernen geprägt. Die hatten sehr starke Probleme – die Kosten sind wegen Übernahmen und Konflikten mit den Gewerkschaften außer Kontrolle geraten, was die Aktienpreise gedrückt hat. Man sollte also auf Märkte und Firmen schauen, die nicht so Südafrika-lastig sind.
Das Problem bei den Afrika-Indizes ist, dass sie sehr Südafrika-lastig sind und deshalb unter den extrem negativen Währungseffekten der vergangenen Jahre gelitten haben.
Indizes sind ja der Spiegel der investierbaren Aktienmärkte. Vielleicht gibt es ja nicht genug investierbare Firmen in Afrika jenseits der großen Märkte Südafrika, Nigeria, Ägypten?
Wir agieren vollkommen unabhängig von Indizes, und wir raten unseren Investoren, das auch zu tun. Institutionellen Kunden schauen sich häufig einzelne Länderindizes an, um ein Gefühl für die lokalen Märkte zu bekommen.
Aber auch ein Blick auf Länderindizes sagt oft nichts darüber aus, ob dieser Markt für westliche Anleger wirklich investierbar ist.
Das stimmt, aber die Lage hat sich schon stark verbessert. Der interessanteste Markt bezüglich der Liquidität und der Auswahl an gut geführten Firmen ist mit großem Abstand Nigeria, die größte Volkswirtschaft Afrikas. Nigeria hat nicht nur eine liquide Börse, man kann auch in verschiedene Sektoren investieren, Konsumgüter, Banken, Telekoms. Der Markt hat mittlerweile eine sehr viel gesündere Struktur, weil die lokalen Versicherungsgesellschaften und Pensionsfonds in großem Stil investieren, was sie früher nicht durften. Es gibt also eine gute Mischung zwischen ausländischen und lokalen Investoren.
Wie hoch ist in Nigeria der Anteil ausländischen Finanzinvestoren am Aktienmarkt?
Auch wenn einige ausländische Anleger Nigeria entdeckt haben, liegt der von Ausländern gehaltene Anteil am Aktienmarkt nur zwischen 10 und 25%. Das ist im Vergleich zu anderen Emerging Markets relativ wenig. In der Türkei befindet sich beispielsweise 70% des lokalen Markts in ausländischer Hand. Die günstigen Bedingungen findet man prinzipiell auch in Kenia, wobei dieser Markt extrem gut gelaufen und heute nicht mehr ganz billig ist. Der kenianische Markt ist sehr liquide und bietet wiederum Unternehmen aus allen verschieden Sektoren. Banken sind da sehr stark vertreten, aber auch Brauereien, und wir haben dort sogar in eine Werbeagentur investiert. Und das Interessante ist, dass entgegen der gängigen Annahmen man nicht unbedingt auf Rohstofffirmen setzen muss. Pure Rohstofffirmen haben wir so gut wie gar nicht im Portfolio, uns geht es vielmehr darum, so gut wie möglich die lokale Konsumstory einzufangen, und das gelingt uns immer besser.
Auch wenn ausländische Anleger Nigeria entdeckt haben, liegt der von Ausländern gehaltene Anteil am Aktienmarkt nur bei 10 bis 25%. Das ist im Vergleich zu anderen Emerging Markets relativ wenig.
Aber nach Nigeria und Kenia wird es vermutlich mit der Liquidität schwierig?
Ich würde es so formulieren: Man braucht Geduld. Eine größere Position in Zimbabwe aufzubauen, kann schon ein paar Wochen dauern. Manche Aktien haben ein Handelsvolumen von nur 20.000 Dollar pro Tag. Deshalb ist bei Afrika-Investments das Aufspüren von guten Unternehmen das eine. Das andere ist die Frage, ob man deren Aktien auch kaufen kann. Dafür braucht man eine sehr gute Handelsabteilung.
Vermutlich handeln Sie nicht nur direkt an der Börse, sondern auch mit anderen Institutionen?
Genau. Da muss man gut vernetzt sein. Wir müssen im Blick haben, wer die Positionen hält, wer verkaufen will und wer kaufen, und dann versuchen wir, da durch zu navigieren. Aber eigentlich sind wir auf diese Art des Handels immer weniger angewiesen, weil sich die Liquidität über die Jahre nachhaltig deutlich verbessert hat.
Aber es gibt auch Situationen, in denen Sie gar nicht zurande kommen mit der Marktliquidität.
Die gibt leider immer noch ziemlich oft! Wir waren schon einige Male in Tansania und haben uns wirklich hervorragende Unternehmen angeschaut. Ich hätte gerne in einige Banken und eine Brauerei investiert. Aber da reinzukommen war völlig unmöglich. Das lag in einem Beispiel an der Eigentümerstruktur, in anderen an der nicht vorhandenen Liquidität. Dasselbe haben wir auch in anderen Märkten erlebt. Und dann gibt es Märkte wie Äthiopien, in die Ausländer keine Zulassung zum Handel an der Börse bekommen. Das gilt auch für Angola, wo wir gerne investieren würden. Zum Glück kann man den Umweg über London gehen, wo einige Aktien afrikanischer Unternehmen gelistet sind. Etwa 10 bis 15% der Firmen, an denen wir uns beteiligt haben, sind außerhalb Afrikas gelistet.
Es klingt durch, dass Banken eine sehr wichtige Bedeutung für Investments in Afrika haben. Ich hätte vermutet, dass Sie häufiger Telekomunternehmen nennen, schließlich spielt das mobile Banking in Afrika eine sehr große Rolle.
Mobiles ist in Afrika tatsächlich ein Riesenthema. Gerade in Kenia gibt es sehr erfolgreiche mobile Banking-Systeme. Es ist also nicht mehr die Bank, sondern die Telekomfirma, die es Kunden ermöglicht, Geld von A nach B per SMS zu überweisen. Es hat eine Revolution stattgefunden, die für ein unglaubliches Geschäftsvolumen und Transaktionsvolumina gesorgt hat. Die Frage ist nur: Wie fängt man diesen Trend ein? Es ist gar nicht so einfach, direktes Exposure zu den lokalen Telekomfirmen zu bekommen, denn die werden immer mehr von globalen Konzernen wie Vodafone oder Orange gekauft, insofern ist die Auswahl nicht mehr so groß.
Wenn ich mir das Portfolio des Templeton Africa anschaue, dann setzt es sich zu 38% aus Finanzaktien und nur zu 15% aus Telekom-Dienstleistern zusammen. Ist das der Umweg über die Kreditgeber, also ein indirektes Exposure zum mobilen Banking , das nicht von Banken betrieben wird?
Nicht ganz. Die Banken geben uns die Möglichkeit, an vielen verschiedenen Sektoren teilzuhaben. Sie vergeben ja nicht nur Kredite an Telekomfirmen. Die Bankenstory steht schon für sich. Zum einen sind sie sehr profitabel. Der große Unterschied zwischen den Geschäftsmodellen der Banken in den Frontiermärkten - gerade in Afrika - und unseren Banken ist, dass sie dort immer noch wirklich die einfachste Form des Banking anwenden. Es werden ganz klassisch kurzfristige Kundenanlagen eingesammelt und auf der anderen Seite kurzfristige Kredite vergeben. Zum anderen haben Banken eigentlich erst begonnen, ihre Flügel auszubreiten und die Konsumenten zu erschließen. Viele Menschen in Afrika haben bisher noch gar nicht an einem Konsumleben, wie wir es kennen, teilgenommen. Sie haben sich die Milch vom Bauern geholt und dabei auf Tauschhandel gesetzt. Das verändert sich gerade in großem Stil, und über die Banken bekommt man Zugang zu diesen neuen Konsumenten – natürlich auch über mobiles Banking.
Nun ist es aber so, dass Währungsrisiken Anlegern einen Strich durch die Rechnung machen können – das Beispiel Südafrika haben Sie ja erwähnt. Man will als Aktienanleger ja auf Unternehmenserfolge setzen. Die Performance mit Währungsrisiken aufs Spiel zu setzen, ist unschön. Lässt sich dieses für Aktieninvestoren unliebsame Risiko ausschalten? Die lokalen Währungen zu hedgen, dürfte schwierig sein.
Es ist nicht nur schwierig, sondern unmöglich. Wir beziehen die Währungsrisiken schon auf der Ebene der Unternehmensanalyse ein. Wenn wir meinen, dass diese Risiken zu hoch sind, dann findet das bei der Einschätzung der Attraktivität einer Aktie seinen Niederschlag. Das beste Beispiel ist unser Vorgehen bei südafrikanischen Aktien. Wir sind in Südafrika extrem untergewichtet, und wir haben darüber hinaus dort vor allem in Unternehmen investiert, die auch in anderen Währungen ihr Geld verdienen. Eine riskante Währung zu vermeiden, ist letztlich in Afrika der einzige wirkliche Schutz. Weist ein Land ein sehr hohes Leistungsdefizit auf, dann sollte man sich da lieber etwas zurückhalten.
Das Gespräch mit Carlos Hardenberg führte Ali Masarwah