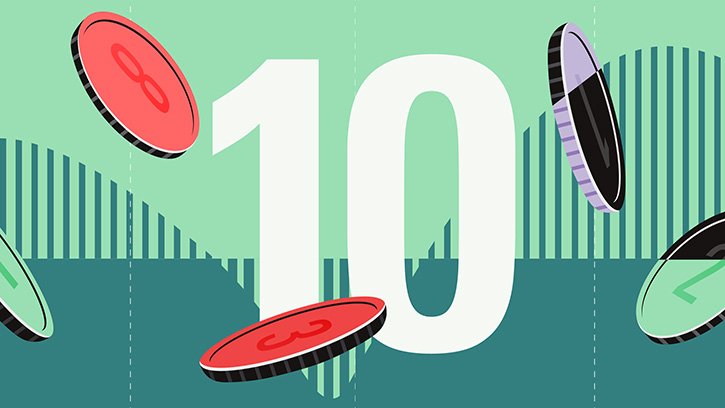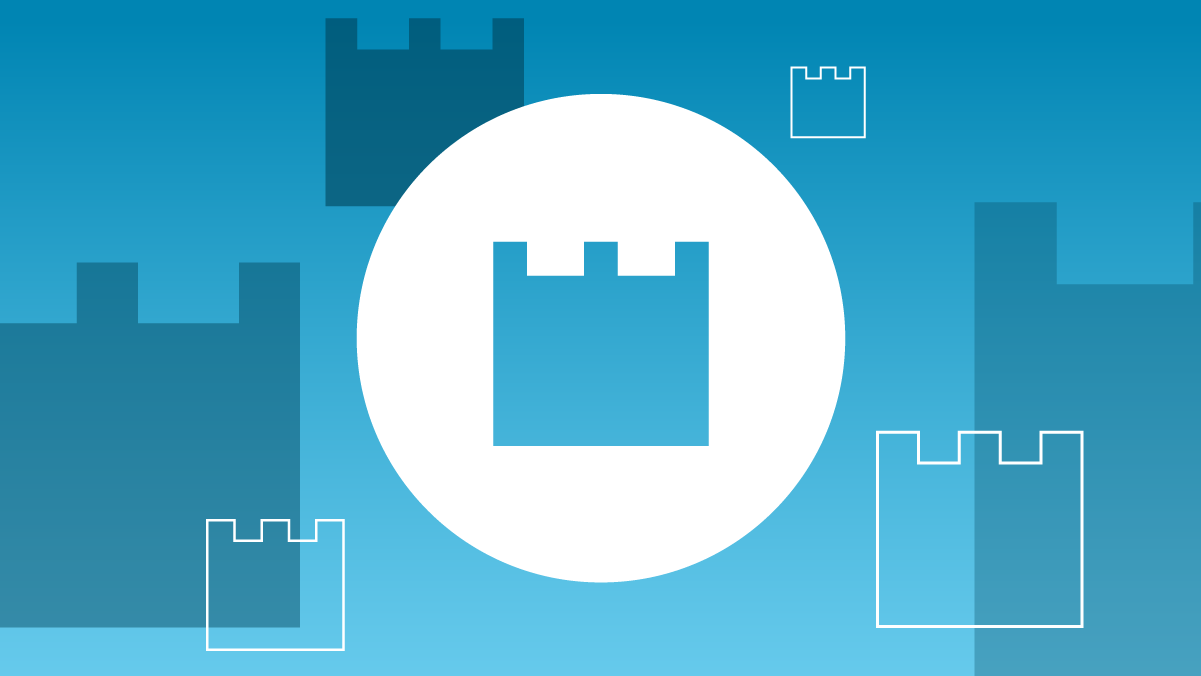Es gehört zu den Eigenarten des Menschen, eindeutige Ursachen für außerordentliche Phänomene zu identifizieren. Das gilt vor allem für die Finanzmärkte, die in den vergangenen Jahren rasant an Komplexität gewonnen haben. Jede Krise nährt zudem den Verdacht, dass die Märkte an sich instabil sind. Die Struktur der Märkte gilt inzwischen problematisch. Gleichzeitig gibt es immer wieder Neuerungen und Innovationen, die unbedachte Folgen für die Handelsaktivität am Aktienmarkt haben können. Diese potenziell oder aktuell disruptiven Faktoren und Tendenzen werden oft als die Schuldigen, die Störenfriede angesehen. Zunächst jedenfalls. Doch wie sehr sollten Veränderungen an den Märkten, Innovationen und neue Akteure als Bedrohung aufgefasst werden, und, vor allem, sollten sie uns abschrecken, uns an den Märkten als Investoren zu engagieren?
Die Versicherung, die keine war
Rückblende: Im Herbst 1987 brachen an den US-Börsen die Dämme. Zuvor hatte sich der Index Dow Jones Industrial Average in lediglich zwei Jahren verdoppelt und im August 1987 bei 2.722 Punkten sein damaliges Allzeithoch erreicht. Die Euphorie über diesen Rekordstand ließ jedoch rasch nach: Bis Mitte Oktober hatten Gewinnmitnahmen diesen Rekordwert des Dows wieder um 20 Prozent abschmelzen lassen. Die Finanzmedien schlugen entsprechend bald einen Unheil verkündenden Ton an. Viele Marktteilnehmer hatten im Oktober das Gefühl, am Abgrund zu wandeln. Das Gleichgewicht verloren sie vollends am 19. Oktober, am so genannten Schwarzen Montag. An diesem Tag rauschte der Dow Jones um gut 22 Prozent in die Tiefe.
Was hatte den so genannten Schwarze Montag ausgelöst? Als Sündenböcke wurden schnell Portfolioversicherungen ausgemacht. Dies war eine damals neue und populäre Technik, Portfolios bei fallenden Märkten vor weiteren Verlusten zu schützen. Dafür wurden bei Abwärtsbewegungen Futures verkauft. Die Verdachtskette ging so: Der Aktienmarkt fällt, der Portfolioversicherer verkauft ein Index-Future, der Future-Preis fällt wegen der Verkaufsorders, die fallenden Futures werden von Investoren als Warnsignal verstanden, die dann ihre Aktien verkaufen. Der Aktienmarkt fällt weiter, und das Ganze geht in einer Wiederholungsschleife von vorne los. Portfolioversicherungen hatten sich rasant verbreitet. Sie kamen quasi aus dem Nichts und machten innerhalb von nur zwei Jahren den Löwenanteil im Future-Handel aus. Die Orders erfolgten zudem nicht einzeln, sondern meist gebündelt.
Diese Erklärung klingt schlüssig. Allerdings relativierte die US-Börsenaufsicht SEC im Zuge einer Untersuchung das wie folgt: Laut der SEC waren Portfolioversicherungen nicht die alleinige Wurzel des Crashs, aber ein „wesentlicher Faktor“, der einen dunklen Tag noch dunkler machte.
Die große Unbekannte war aber das Ausmaß. Es ist nicht klar, in welchem Umfang die Veränderungen bei den Future-Preisen den Aktienmarkt beeinflusst hatten. Seit dem Schwarzen Montag ist sich die SEC über die potenzielle Tragweite unbeabsichtigter Folgen von Neuheiten im Aktienmarkt bewusst –wie andere Marktbeobachter auch. Die Finanzmedien konnten nicht genug von Gruselgeschichten über Derivate kriegen, vor allem, wenn sie von Fondsmanagern gehalten wurden. (Vor einigen Jahren, als ich zu Gast bei einem Finanznachrichtenformat war, hörte ich einen „Experten“, der diese Anführungszeichen vollkommen verdient, folgendes sagen: Die Anteilsrücknahmen beim Rentenfonds PIMCO Total Return würden zu einem Anleihen-Crash führen, weil der Fonds seine Derivate abwerfe. Ich warte immer noch auf diesen Crash.)
Neue Gefahren durch den großen Indexierungstrend?
Während der vergangenen Jahre wanderte der prüfende Blick von Futures und Optionen zum allgemeinen Trend am Markt, Kapitalanlagen zu indexieren. Den Anfang machten Exchange Traded Funds (ETFs). Sie gerieten wegen ihres Handelsmechanismus in den Fokus. Diese Mechanismen haben immer wieder Aussetzer gehabt. In einigen Fällen brach der Preis von ETFs abrupt ein, während der Korrektur im August 2015 wurden zahlreiche ETFs vom Handel ausgesetzt, und einige hatten auch Tage danach Pricing-Probleme. Das versetzte Investoren in Angst und Schrecken. Die Grundlage für die Rückschlüsse auf ETFs als die wahren Schuldigen der Marktvolatilität, nach dem Motto: „böses Wertpapier bringt Marktinstabilität“, war indes noch dünner als der seinerzeitige Connex zwischen Futures-Handel und Aktien-Crash im Jahr 1987. Für den „Flash Crash“ von 2010 beispielsweise, bei dem zunächst die Probleme bei ETFs als Hauptverursacher verortet wurden, gab es eine Vielzahl von Ursachen, wie sich später herausstellte.
Das Augenmerk von Marktbeobachtern und Journalisten ist nun also auf das Thema Indexierung gerichtet. Viele aktive Fondsmanager (das sind die, die durch häufige Underperformance ihrer Produkte den Indexierungstrend befeuern) haben die unguten Gefühle vieler Anleger und Beobachter nur allzu gerne aufgegriffen und die Theorie entwickelt, wonach die steigenden Investitionen in nach Marktkapitalisierung gewichtete Indizes eine „Blasenbildung“ verursache. Aktien, die nicht in solchen Indizes enthalten sind, würden hingegen vergessen. Sollte die Blase platzen, so viele Fondsmanager, würden enttäuschte Index-Investoren aus ihren Indexfonds aussteigen und Verkauf von Aktien durch die Indexfonds erzwingen, was die Abwärtsspirale der beliebten Indexschwergewichte noch weiter drehen würde, was wiederum zu weiteren Anteilsrückgaben führen würde und so weiter. Kurzum – es wäre der Schwarze Montag von 1987 in Zeitlupe.
Es gibt nun einen weiteren potenziellen Sündenbock. Erst kürzlich verschob sich das Kreuzfeuer in Richtung Strategic Beta ETFs. Rob Arnott von Research Affiliate, einer der glühendsten Befürworter dieses Ansatzes, trat als Co-Author eines Artikels mit dem Titel „Wie kann ‚Smart Beta’ fürchterlich schieflaufen?“. In diesem Artikel führte Arnott die Diskussion um eine Index-Blase einen Schritt weiter und dachte laut darüber nach, ob der Boom bei Strategic Beta ETFs – also Strategien, die Faktoren wie Value, Momentum oder eine niedrige Volatilität ausnutzen – zu weit gegangen sei: Hat die akademische Entdeckung dieser „Anomalien“ den Boden für ihre eigene Zerstörung bereitet, weil neues Geld die Aktienpreise bis zu dem Punkt in die Höhe treibt, an dem die Blase platzt?
„Wir sehen eine begründete Wahrscheinlichkeit eines Smart Beta Crashs als Folge der rapide steigenden Popularität von Factor-Tilt-Strategien“, schreibt Arnott. (Es ist übrigens pure Ironie, dass ausgerechnet Arnott diese Bedenken vorträgt. Angesichts der Daten, die Arnott präsentiert, bin ich weniger von seiner These überzeugt. Aber das ist ein anderes Thema.) Es genügt, festzuhalten, dass es das Thema Strategic Beta ebenfalls auf die Liste der potenziellen Aktienmarkt-Gefährdern geschafft hat.
Die Moral der Geschichte:
1) Es ist schwierig, die Effekte von neuen Finanzinstrumenten für den Aktienmarkt von anderen Gründen für einen Crash abzugrenzen. Es ist jedoch naheliegend anzunehmen, dass es immer mehr als einen Grund für eine abrupte Korrektur gibt. Dem Platzen einer Blase geht in aller Regel irrationaler Optimismus der Anleger voraus.
2) Allerdings liegt den Befürchtungen über die dispruptive Wirkungsweise von neuen Instrumenten oder Techniken ein gewisser Wahrheitsgehalt zu Grunde.
3) Es besteht heute ein noch größerer Anlass zur Sorge, als das in der Vergangenheit der Fall war. Neben börsengehandelten Derivaten gibt es einen riesigen Markt für maßgeschneiderte Derivate, plus ETFs, plus die Zunahme von weiteren Indexierungsformen, plus der Auftauchen des Hochfrequenzhandels. Aber aus diesen Punkten eine Gruselgeschichte zu konstruieren, wäre vermessen.
Wir wissen nicht, ob sich einer dieser Punkte als destabilisierend für die Märkte herausstellen wird. Wir können es aber auch nicht ausschließen. Auf keinen Fall sollte die Aufzählung möglicher Gefahrenquellen als generelle Warnung vor Aktieninvestments verstanden werden. Viele Anleger sind langfristig engagiert. Dieser Artikel richtet sich vielmehr an die Weisen. Viele Merkmale des Aktienmarkts haben sich in den jüngsten Jahren verändert. Man sollte daher nicht überrascht sein, wenn immer wieder Störfeuer aufflackern. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.