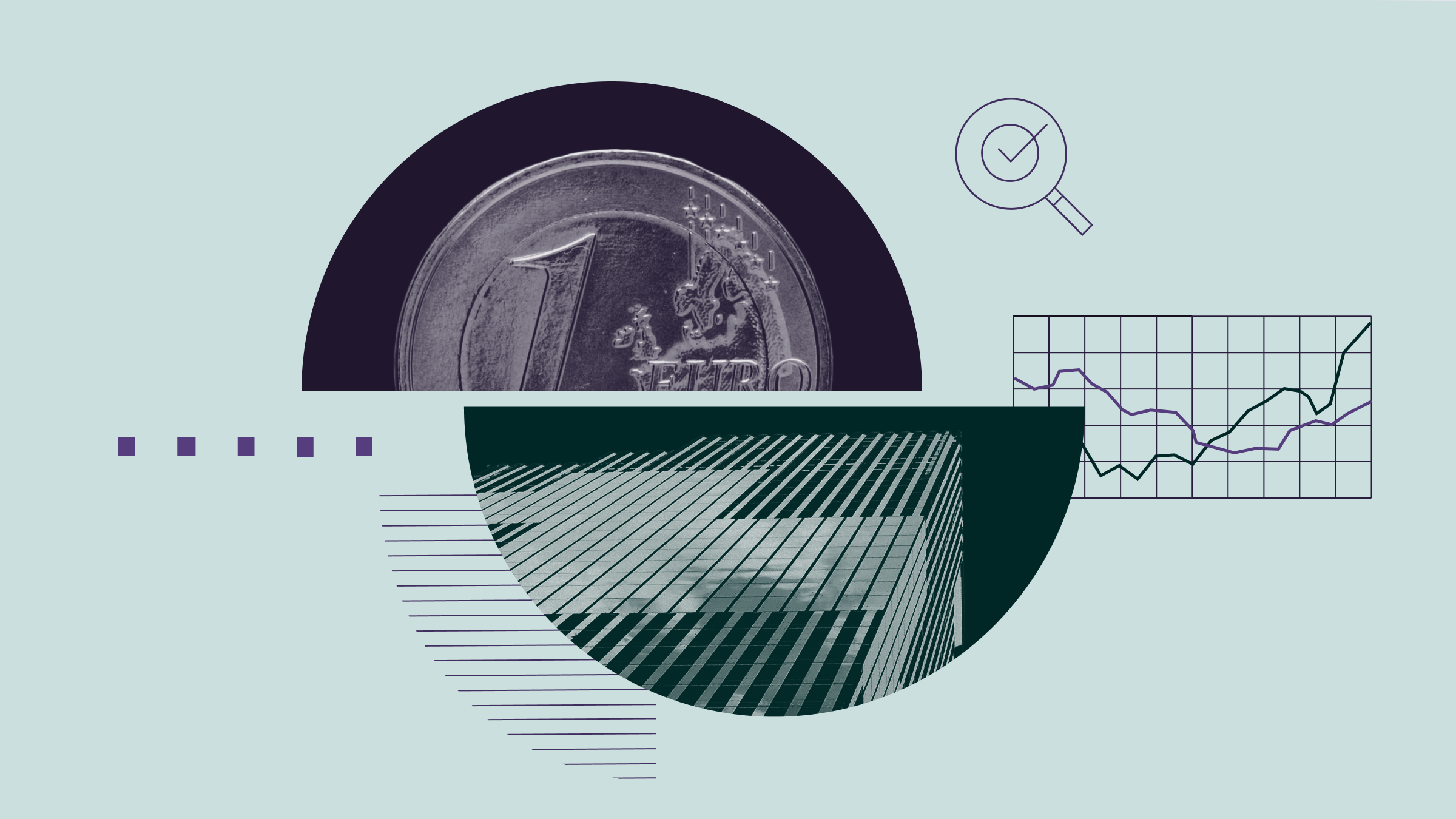Die Gilde der Consultants ist schnell dabei, wenn es darum geht, schlagzeilenträchtige Botschaften zu verkünden. In der Asset Management Industrie geht die Kunde von einer „Disruption“ um. ETFs und andere Indexfonds seien dabei, die Grundfesten der Branche zu erschüttern. Da aktiv verwaltete Fonds ihre Indizes regelmäßig hinterherhinkten und Indexfonds konkurrenzlos günstig seien, würden Indexfonds die Geschäftsmodelle der etablierten Akteure unterminieren, so die These. Die erfolgsverwöhnte Industrie stehe vor einem Erdbeben, die Zukunft gehöre den Index-Innovatoren. (Eine Google-Suche zu den Stichworten "disruptive" und "ETF" ergab 348.000 Ergebnisse!)
Diese Vision klingt auf den ersten Blick plausibel. Investoren wenden sich tatsächlich seit der Finanzkrise verstärkt Indexfonds zu. Und da die Vergütung des Vertriebs über die Produktkosten (vulgo: Kickbacks) immer stärker als intransparent und eine für Anleger schädliche Incentivierung des Vertriebs kritisiert wird, steigen auch Banken und Vermögensverwalter auch im Zuge von regulatorischen Zwängen - Stichwort: Mifid II - stärker in den Vertrieb von Indexfonds ein.
Woran Geschäftsmodelle und Organisationen in der Praxis scheitern
Doch in der Diskussion geht der differenzierte Blick oft verloren. Sind ETFs wirklich der Totengräber der Asset Management-Branche? Ist die Herausforderung passiver Fonds tatsächlich als „Disruption“ zu beschreiben, also als Innovation, welche die Geschäftsmodelle der Fondsmanager zum Einsturz bringen wird? Ich stelle die These auf, dass es sich hier um eine Übertreibung handelt, der vermutlich ein nur oberflächliches Verständnis des Begriffs „Disruption“ zugrunde liegt. Zudem werden in der heutigen Debatte erschreckend selten die Gründe für das typische Scheitern von etablierten Unternehmen bei der Einführung neuer Technologien thematisiert. Das ist bedauerlich, denn an Erklärungsansätzen mangelt es nicht. Unternehmen wir eine kurze Reise durch die aktuellen Diskussionen in der Business-Literatur zum Thema „Disruption“.
Tim Harford einer der prominentesten Journalisten-Ökonomen hat jüngst in der Financial Times einige spektakuläre Fälle geschildert, in denen es Organisationen nicht gelang, Innovationen zu adaptieren, obwohl sie selbst Träger der neuen Technologie waren. Eines der Beispiele war der Einsatz des Kampfpanzers während des Ersten Weltkriegs. Erfunden hatten ihn britische Techniker, doch der Erfolg war sehr übersichtlich. Bekanntlich waren es die Deutschen, welche die Panzerwaffe mit durchschlagendem Erfolg im Zweiten Weltkrieg einsetzten. In den 1970ern erfand das Innovationslabor Xerox Parc einen höchst nutzerfreundlichen PC mit graphischer Oberfläche und Maus. Bekanntlich konnte Xerox daraus kein Kapital schlagen. Und 1999 führte Sony den Memory Stick Walkman ein, den ersten digitalen Tonträger, der nie die Erwartungen erfüllte und sang und klanglos von Apples iPod überrollt wurde.
Sind große Organisationen unvermögend, neue Technologien einzuführen?
Es gibt verschiedene Erklärungen für das Scheiterten dieser Organisationen an der Einführung neuer Technologien. Zunächst die Feststellung, dass der Grund des Scheiterns zumeist nicht an der mangelnde Intelligenz oder im mangelhaften Verständnis der Betroffenen liegt. Die Sache ist naturgemäß viel komplizierter. Der Harvard-Ökonom Clayton Christensen hat in seinem Standardwerk The Innovator’s Dilemma die These aufgestellt, dass große Organisationen nicht darauf eingestellt sind, neue Technologien in einem mühevollen Prozess zur Marktreife zu entwickeln. Neue Technologien seien in ihrem ersten Stadium nicht massentauglich. Weil aber große Organisationen große Ziele verfolgten, fehle ihnen die Geduld, neue Entwicklungen aus der Nische heraus zur Standardware zu begleiten.
Eine alternative Deutung bieten Rebecca Henderson und Kim Clarke an, die das Problem des Umgangs großer Organisationen mit Innovationen in ihren Strukturen verorten. Demnach verhinderten die bestehenden Strukturen oft eine angemessene Reaktion der Platzhirsche auf die Herausforderungen neuer Technologien, selbst dann, wenn diese aktiv an deren Entwicklung und sogar Markteinführung arbeiteten.
Um bei den oberen Beispielen zu bleiben: Es war nicht das Unvermögen der britischen Armee, die Bedeutung des Kampfpanzers zu erkennen, die seine Einführung lange verzögerte. Vielmehr gelang es ihr nicht, ihn in die bestehende Struktur ihrer Streitkräfte zu etablieren. Zwar war der Ansatz naheliegend, Kampfpanzer in den mobilsten Kampfverband der Armee, die Kavallerie, zu integrieren. Doch das stieß auf wenig Gegenliebe bei den pferdeliebenden Kavallerie-Offizieren, die den gedanklichen Transfer vom Ross zum Stahlross offenkundig nicht leisten konnten oder wollten und somit die Einführung des Panzers behinderten. (Es gab auch andere Gründe, die das Panzerprojekt behinderten; nach dem Ende des Ersten Weltkriegs stand ein radikaler Sparkurs auf der Agenda, der das Rüstungsbudget der britischen Armee aufs Nötigste reduzierte.)
Xeros "konnte" Drucker, aber keine PC
Sony wiederum war zwar auf die Produktion von Unterhaltungselektronik spezialisiert, hatte aber große Probleme, den Memory Stick Walkman in seine siloartige Struktur zu integrieren bzw. die verschiedenen Unternehmensbereiche so zur Zusammenarbeit zu trimmen, dass das neue Produkt erfolgreich lanciert werden konnte. Ähnlich der benutzerfreundliche PC von Xerox. Dem Unternehmen fehlte die Organisationsstruktur, um die Innovation seines Forschungslabors zur Serienreife zu bringen, weil es nicht in die bestehende Produktpalette passte. (Ganz anders beim Laserdrucker, der ebenfalls von Xerox Parc entwickelt wurde – der passte wiederum hervorragend in die Xerox-Denke und wurde zum Verkaufsschlager.)
Bereits dieser kleine Exkurs in die Geschichte von Disruptionen in der Unternehmenswelt zeigt, dass die Indexfonds in der Fondsbranche in einer ganz anderen Liga spielen. Es sind Vermögensverwaltungsprodukte, die von den identischen Playern produziert werden wie aktiv verwaltete Fonds und die von den identischen Vertriebskanälen an den Mann und die Frau gebracht werden. Heute sind selbst ETFs im Beratermarkt etabliert, auch die Schnittstellenproblematik, die der Börsenvertrieb mit sich bringt, ist kein Hindernis mehr für den Einsatz von ETFs. Und dass ETFs zur Renaissance des Selbstentscheiders führen, ist bisher nur ein Mythos: Es hat schon immer Selbstentscheider gegeben, die rege in Aktien und Anleihen – vor 20 Jahren war die Stückelung deutlich anlegerfreundlicher! – investieren. Diese wenden sich nunmehr ETFs zu.
Indexfonds sind längst ein fester Bestandteil des Angebots vieler Fondshäuser
Der Umgang der Fondsanbieter mit dem Instrumentarium Indexfonds lässt übrigens nicht darauf schließen, dass Indexfonds eine Revolution darstellen. Ob BlackRock, DWS, UBS, Credit Suisse, Société Générale, Amundi, Swisscanto, HSBC, Pictet, Invesco oder PIMCO: alle diese Häuser, und noch viele mehr, bieten seit Jahren Indexfonds an, ohne dass man eine drohende Pleite befürchten müsste – im Asset Management wird spektakulär gut verdient, kommen im großen Stil Indexfonds hinzu sind die Margen zwar nicht mehr ganz so prächtig, aber noch immer deutlich besser als nur mittelprächtig. Im Schnitt kosten Aktien-ETFs in Europa übrigens noch immer 0,37 Prozent pro Jahr. Das ist mehr, als manche Beobachter vermuten würden.
Weil sich Indexfonds in die bestehende Struktur von Fondsproduzenten einfügen lassen, ist es auch weniger problematisch, passive Fonds in Häusern einzuführen, wo die Existenz einer vermeintlich „aktiven DNA“ unterstellt wird. Dass dies eher unfreiwillig nach dem Motto: “If you can’t beat them, join them” passierte, ändert nichts daran, dass gerade Fidelity derzeit große Vertriebserfolge mit Indexfonds feiert. (Das Geschäftsmodell von Fidelity ist diversifizierter, als es die meisten Beobachter hierzulande meinen. Wussten Sie, dass das Bostoner Haus einer der größten Fondsplattformen in den USA ist und bis 2013 sogar einen Limousinenservice unter dem Namen „BostonCoach“ betrieb?)
Erleichtert wird aktiven Managern der Einstieg in das Indexfondsgeschäft übrigens auch mit dem Kunstgriff auf "Strategic Beta". In Strategic Beta Produkten werden semiaktive Strategien implementiert, mit denen Portfolios nicht nach Marktkapitalisierung gewichtet werden, sondern nach Algorithmen, die entweder ein besseres Rendite- oder ein überlegenes Risikoprofil versprechen als herkömmliche Indizes. Hier haben die Anbieter also die Möglichkeit, mit - tatsächlich oder vermeintlich - "überlegenen" Strategien Anlegern den Einstieg in die Alpha-Jagd auch bei Indexvehikeln schmackhaft zu machen.
Mit "Strategic Beta"-ETFs haben Anbieter die Möglichkeit, auch Indexfonds-Investoren den Einstieg in die Alpha-Jagd schmackhaft zu machen
Auch wählen Fondsproduzenten - vor allem in den USA - ETFs auch als "Hülle" für aktive Strategien. Hier kommt die Funktion von ETFs als Vertriebsvehikel zum Tragen. Man könnte also die These aufstellen, dass ETFs dazu angetan sind, einen neuen Vertriebsweg, nämlich die Börse, für Asset Manager zu erschließen, die bisher nur im so außerbörslichen Bereich, dem so genannten Handel zum NAV, aktiv waren. ETFs wäre dann also eine Art Steigbügelhalter für Fondsanbieter in einem bisher nicht erschlossenen Vertriebsweg und eben nicht der Todesengel einer Branche in der Krise. (Vergegenwärtigt man sich, dass im Asset Management im Schnitt noch immer Margen von 30 Prozent und mehr üblich sind, drängt sich der Verdacht auf, dass hier auf sehr hohem Niveau geklagt wird.)
Manche Häuser halten den Banner des aktiven Managements hoch
Natürlich ist die Frage nach dem Umgang von Firmen, die sich bisher dem aktiven Asset Management verschrieben haben, mit der Herausforderung Indexfonds spannend. Nicht jedes Haus wird sich Indexfonds verschreiben: Mit Allianz Global Investors unter seinem Chef Andreas Utermann, einem passionierten Verfechter von Research-getriebenem Asset Management, findet man hierzulande einen prominenten Verfechter des aktiven Managements; in den USA stehen American Funds, MFS oder Dodge&Cox für die Orthodoxie des aktiven Managements.
Gerade die Einführung neuer Preismodelle bei AGI und Fidelity (wo noch immer mehr als 80% der weltweiten Fonds-Assets in aktiv verwalteten Produkten stecken), bei denen die Outperformance der Fonds als maßgebliches Kriterium für die Vergütung des Managements in den Mittelpunkt gerückt wird, zeigt, dass die Verbreitung von Indexfonds die Branche in Bewegung hält - aber wer wollte deshalb auf einen baldigen Untergang von AGI, American Funds oder setzen?
Dass Indexfonds nicht das Zeug zur destruktiv-disruptiven Katharsis haben, ändert natürlich nichts an der hohen Wahrscheinlichkeit, dass die Fondsbranche in den nächsten Jahren einen Konsolidierungsprozess durchlaufen wird. Die Hürde für die Einführung neuer Vermögensverwaltungsprodukte ist im Zuge der diversen Outsourcing-Regelungen in den vergangenen Jahren deutlich niedrigschwelliger worden, sodass auch kleinste Vermögensverwalter mit Fonds auf den Markt drängen. Im Zuge der anziehenden Regulierung und der zunehmend kritischen Haltung vieler Investoren gegenüber teuren aktiv verwalteten Produkten dürften viele hoffnungsfrohe Asset-Jäger noch schneller als bisher vom Markt verschwinden. Doch das sollte man tunlichst unter dem Schlagwort „Professionalisierung“ der Branche verbuchen, so, wie man dem Abschied von den hunderttausenden nebenberuflichen Versicherungsverkäufern nicht unbedingt nachtrauern muss.