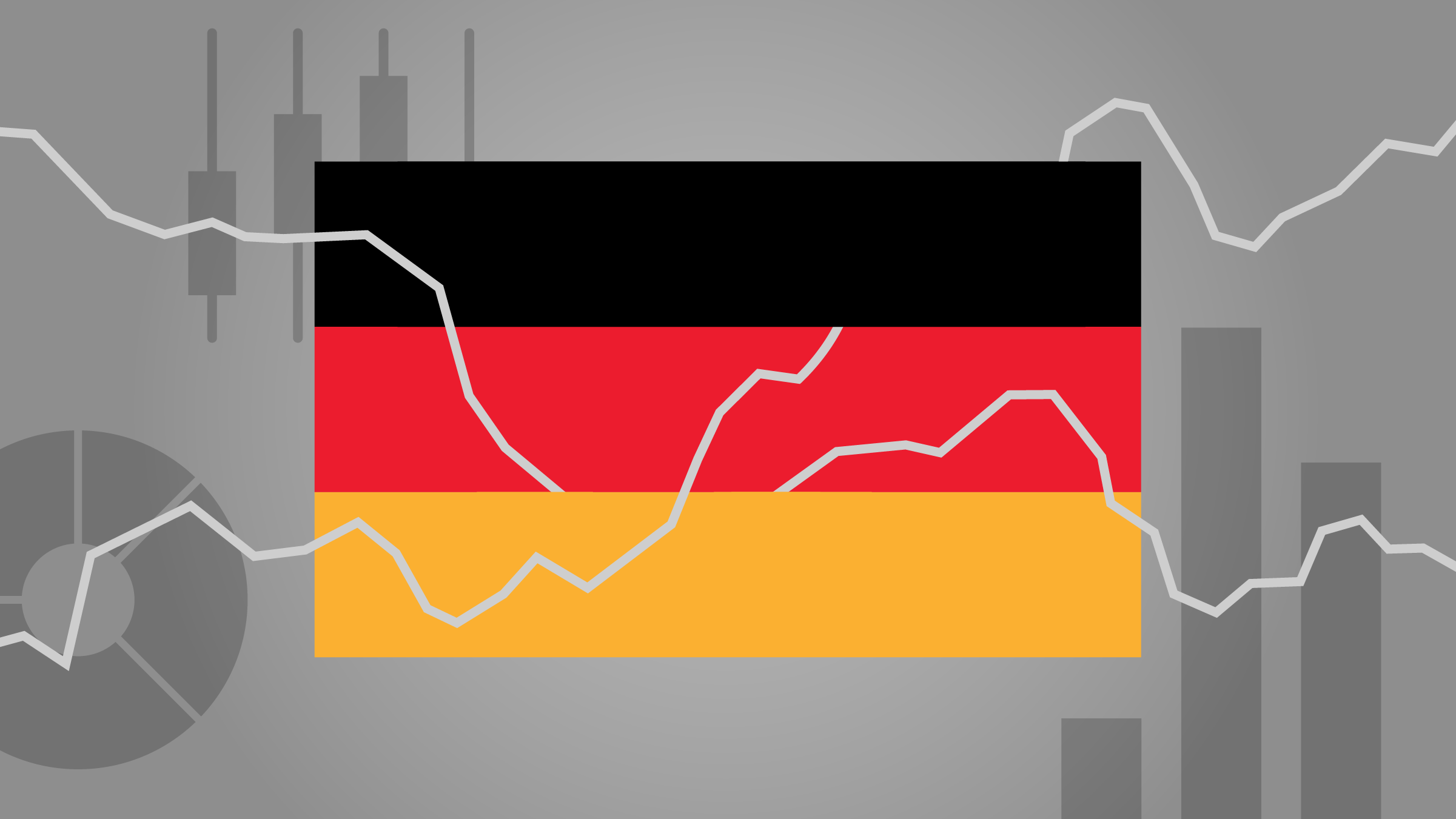Von der Vorstellung, dass es sich bei Investoren um knallhart kalkulierende Profis handelt, die ihren Profit maximieren, hat sich die Finanzwissenschaft mehrheitlich schon längst verabschiedet. Stand früher der Nutzen maximierende Homo Oeconomicus im Mittelpunkt der Betrachtung, so nimmt die Lehre von der Verhaltensökonomie immer mehr Raum in den Finanzwissenschaften ein. Sie hat den irrationalen, von Emotionen gesteuerten Menschen im Blick.
Die immer stärker an Hochschulen etablierte Disziplin des Behavioral Finance erforscht die typischen Fehler von Investoren, ihre Ausprägungen und Folgen. Die Wirtschaftswissenschaften werden dabei immer mehr – zu Recht – in den Rang der Gesellschaftswissenschaften erhoben, was dazu führt, dass die Analyse über unser Handeln an der Börse zunehmend von der Psychologie, Soziologie und auch den Neurowissenschaften befruchtet wird.
Wir wollen einige der vielen Anlegerfehler aufführen, die in den vergangenen Jahren von Verhaltensforschern und Ökonomen wie Amos Tversky und Daniel Kahneman, Richard Thaler oder George Akerlof und Robert Schiller benannt wurden – und wie man gegen sie angeht.
1. Der Ankereffekt. Das so genannte Anchoring beschreibt das Phänomen, dass wir uns im Bemühen, Sachverhalte zu erfassen bzw. zu vereinfachen, gedankliche Eselsbrücken bauen, die mit Zahlen unterlegt sind, die nicht unbedingt auf logische Art gesetzt werden. Wir setzen also Wegmarken zur Orientierung, die aus völlig anderen Kontexten entnommen werden können. Auf diese Art den Ausgangspunkt zu definieren, führt logischerweise oft zu gravierenden Fehleinschätzungen. Auch Finanzprofis sind nicht vor derartigen Fehlern gefeit. James Montier etwa bat in einer Umfrage im Jahr 2005 rund 200 Fondsmanager, die letzten vier Ziffern ihrer Telefonnummer aufzuschreiben. Anschließend sollten sie die Zahl der Ärzte in London schätzen. Beide Zahlen haben nichts miteinander zu tun. Dennoch schätzten die Fondsmanager mit den höheren Telefonnummer-Werten die Zahl der Ärzte höher ein, als es die Fondsmanager taten, deren Telefonnummern niedrigere Werte aufwiesen. Es gibt auch ein „visuelles Ankerphänomen“, wonach künftige Anlageergebnisse anhand bestimmter Chartverläufe aus der Vergangenheit geplant werden. Geht es also um ein Investment, sollten Anleger überlegen, warum sie einen bestimmten Kurs für zu hoch oder optimal zum Einstieg ansehen. Fundamentales Research, sei es auf Fonds- oder auf Aktienebene, hilft viel mehr als willkürliche „Anker“ zu werfen.
2. Mental Accounting: Zwecks Vereinfachung und zur besseren Übersichtlichkeit „führen“ Anleger „getrennte Bücher“ über ihre verschiedenen Vermögensformen. Girokonto, Sparkonto, Wertpapierdepot, Lebensversicherung, Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung: Allzu oft werden diese Posten getrennt geführt - und entsprechend getrennt bewertet. Das kann zu gravierenden Fehlallokationen führen. Wer eine Lebensversicherung bespart, kann es sich leisten, eine höhere Aktienquote im Wertpapierdepot zu fahren, als ein Anleger, der keine Lebensversicherung besitzt, die in ihrer klassischen Variante ein Bond-ähnliches Profil aufweist. (Lebensversicherungen bringen jährliche Kupons, die thesauriert werden, und am Laufzeitende steht die Auszahlung eines fixen Betrags.) Heute stehen Investoren viel bessere Tools zur Verfügung als in der Vergangenheit. Nahezu jede Online Bank bietet Finanzplanungs-Tools an, die eine aggregierte Vermögensübersicht ermöglicht. Diese Tools sollten Sie nutzen, sofern Sie nicht ohnehin mit einem Finanzplaner zusammenarbeiten.
3. Verlustaversion. Anleger sind risikoavers. Es liegt in der Natur des Menschen, Verluste viel stärker wahrzunehmen als spiegelbildliche Gewinne. Deshalb realisieren Investoren Gewinne zu schnell - man zieht den Spatz in der Hand der Taube auf dem Dach vor. Spiegelbildlich lassen Anleger Verluste zu lange „laufen“, weil sie die schmerzliche Realisierung von Verlusten vor sich herschieben. Das Problem wird verschlimmert, wenn sich Anleger bedenkliche Faustregeln zurechtlegen, um ihr Handeln zu rechtfertigen, etwa diese: „when in trouble, double“. Oder sie pervertieren eigentlich sinnvolle, disziplinierende Investment-Regeln wie das Rebalancing, um die Verlustposition partout im Portfolio behalten zu können. Tversky und Kahneman haben dieses Verhalten auch als „Prospect Theory“ bekannt gemacht. Sie erklärt das Phänomen, dass Menschen im Ergebnis bei Gewinnen risikoavers agieren und bei Verlusten das Risiko regelrecht suchen – eben, weil sie intuitiv falsche Entscheidungswege verfolgen. Es gibt etliche Rezepte gegen dieses Verhalten, etwa eine breite Streuung der Vermögensanlage vorzunehmen, regelmäßig bzw. regelbasiert zu sparen, Verluste strikt zu begrenzen und Gewinne laufen zu lassen.
4. Home Bias. Dieser Effekt wird häufig ebenfalls mit einer vermeintlich nüchternen Analyse verbrämt. Man kauft, was man meint zu kennen. Aber kennt man heimische Unternehmen wirklich so gut, dass man willentlich ein hohes Konzentrationsrisiko in Kauf nehmen will? Anleger in Deutschland, auch solche mit Expertenwissen ausgestattet, die Autowerte im DAX übergewichtet hatten, dürften seit drei Jahren auf keine gute Erfahrung zurückblicken. Dass sie nicht vom weitreichen Betrug von VW und Co. wussten, kann ihnen nicht angekreidet werden. Aber spätestens seither müssen sie sich ins Regelbuch schreiben, dass man mit idiosynkratischen Risiken sparsam umgehen und Investments breit streuen sollte - zumal bei Fondsinvestments. Besonders problematisch ist der Home Bias, wenn die lokalen Märkte ohnehin hoch konzentriert sind, wie etwa der Schweizer SMI oder der österreichische ATX. Oft gesellt sich dann ein Sektorrisiko zum Länder- und Einzeltitelrisiko hinzu. US-Anleger verfügen mit dem S&P 500 immerhin auf Ebene der Einzeltitel ein breit gestreutes Referenz-Portfolio.
5. Selbstüberschätzung/Overconfidence. Wenn 86 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage behaupten, überdurchschnittlich gute Autofahrer zu sein, dann kann das nicht mit rechten Dingen zugehen. Doch genau das haben Autofahrer in Deutschland in einer Dimap-Umfrage aus dem Jahr 2014 behauptet. Solche absurden Umfrageergebnisse sind keine Ausnahme und werden auch aus anderen Ländern berichtet. Vor solchen Verhaltensfehlern sind auch Investoren nicht gefeit. Die Überschätzung eigener Fähigkeiten wird als Dunning-Kruger-Effekt bezeichnet. In ihrem Papier stellten David Dunning und Justin Kruger 1999 die These auf, dass sich das Handeln inkompetenter Menschen in schlechten Leistungen niederschlägt. Bei manchen bedingt diese Inkompetenz die Unfähigkeit, die eigene Inkompetenz sowie die überlegenen Fähigkeiten anderer zu erkennen. Retail-Investoren, die glauben, den Profi-Händlern von Goldman Sachs oder JPMorgan ein Schnippchen schlagen zu können, dürften über kurz oder lang Schiffbruch erleiden. An den Kapitalmärkten ist also Demut angesagt – oder die Aneignung von echtem Wissen gefragt (siehe die siebte Sünde.)
6. Kontrollillusion. Dieser Fehler kommt recht häufig vor, ja er ist gewissermaßen Teil unserer DNA. Menschen glauben, dass sie den Ausgang von Ereignissen durch das eigene Handeln beeinflussen können. Ein typisches Beispiel ist der Glaube, dass man eine bessere Gewinnchance im Lotto hat, wenn man die Zahlen selbst ausfüllt, anstatt sie sich durch einen Zufallsgenerator zuteilen zu lassen. Viele Profi-Anleger nehmen das Risiko dann aus dem Portfolio, wenn die Kurse bereits gefallen sind. Wenn Anleger verkaufen, weil sie meinen, „etwas tun zu müssen“, dann untergraben sie mit einer kurzfristigen Absicherungsstrategie oft ihr langfristiges Anlageziel. Diesem Trugschluss unterliegen auch Fondsmanager und Berater, die meinen, in volatilen Märkten „aktiv“ werden zu müssen. Doch wer Kapitalmarktrenditen benötigt, muss die dazugehörige Volatilität aushalten. Anleger sollten nur dann handeln, wenn sie sicher sein können, dass sie etwas in Ihrem Sinne beeinflussen – etwa, wenn sie die Kosten eines Investments senken!
7. Selektive Wahrnehmung bzw. Verfügbarkeits-Heuristik: Hier hängt die identifizierte Ereigniswahrscheinlichkeit von den vorhandenen Informationen ab. Die sind aber häufiger denn nicht unvollständig bis mangelhaft. Recht banal ist das Beispiel des Münzwurfs: Viele Menschen halten die Wahrscheinlichkeit, nach einem dreimaligen „Zahl“-Wurf einen „Kopf“ zu werfen für größer als nach drei „Kopf“-Würfen. Viele Anleger sehen Aktienrenditen von sechs bis acht Prozent pro Jahr als attraktiv. Aber Aktienmarktrenditen stehen nie im luftleeren Raum, sondern haben einen Kontext. Inflationserwartungen bzw. Zinsen sind für die Attraktivität etwa höchst relevant, spielen aber für viele Anleger keine große Rolle bei Formulierung von Rendite-Erwartungen. „Faustregeln“ ohne Kontext bzw. Zusatzinformationen haben also wenig Nutzen. Selektive Wahrnehmung kann auch bei scheinbar üppiger Informationsversorgung drohen. Aktien, die häufig in den Medien erwähnt werden und hinter denen spannende Stories stecken, sind für Anleger hoch attraktiv. Sie steigen im Preis. Das hat oft negative Folgen für die künftigen Renditen. Wenig beachtete Aktien haben dagegen eine bessere Performance-Prognose, eben weil sie von vielen Investoren vernachlässigt werden. Auch das so genannte Recency-Phänomen kann hierzu gezählt werden. Hiernach gewichten Anleger die Bedeutung von Ereignissen in der jüngeren Vergangenheit stärker als länger zurückliegende Events – die jüngste „FAANG“-Hype, welche die Aktien von Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google (Alphabet) in ungeahnte Höhen katapultierte, dürfte auch deshalb zustande gekommen sein, weil die Technologie-Blase der 1990er Jahre bzw. deren Platzen im Gedächtnis vieler Anleger inzwischen verblasst ist.