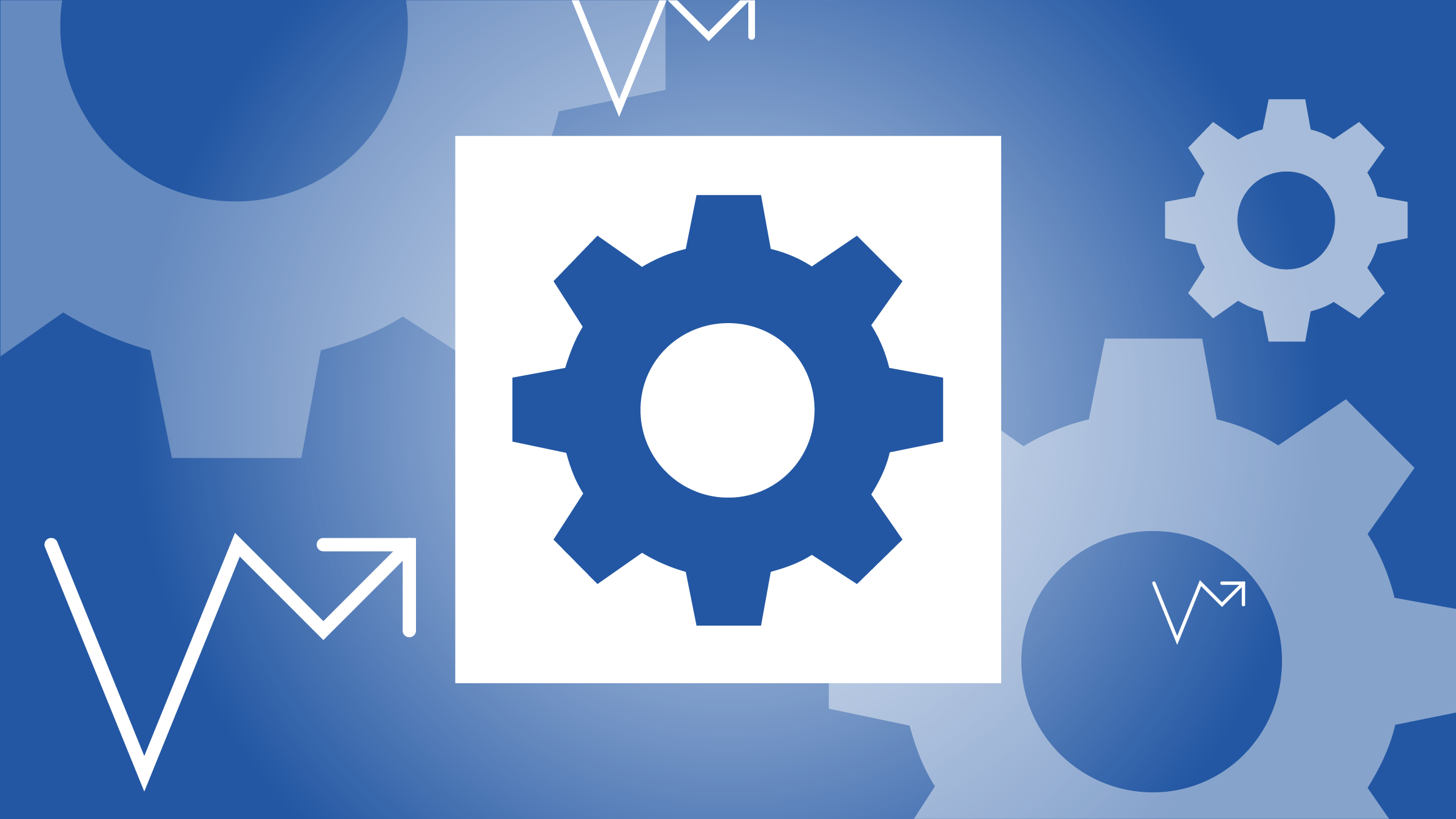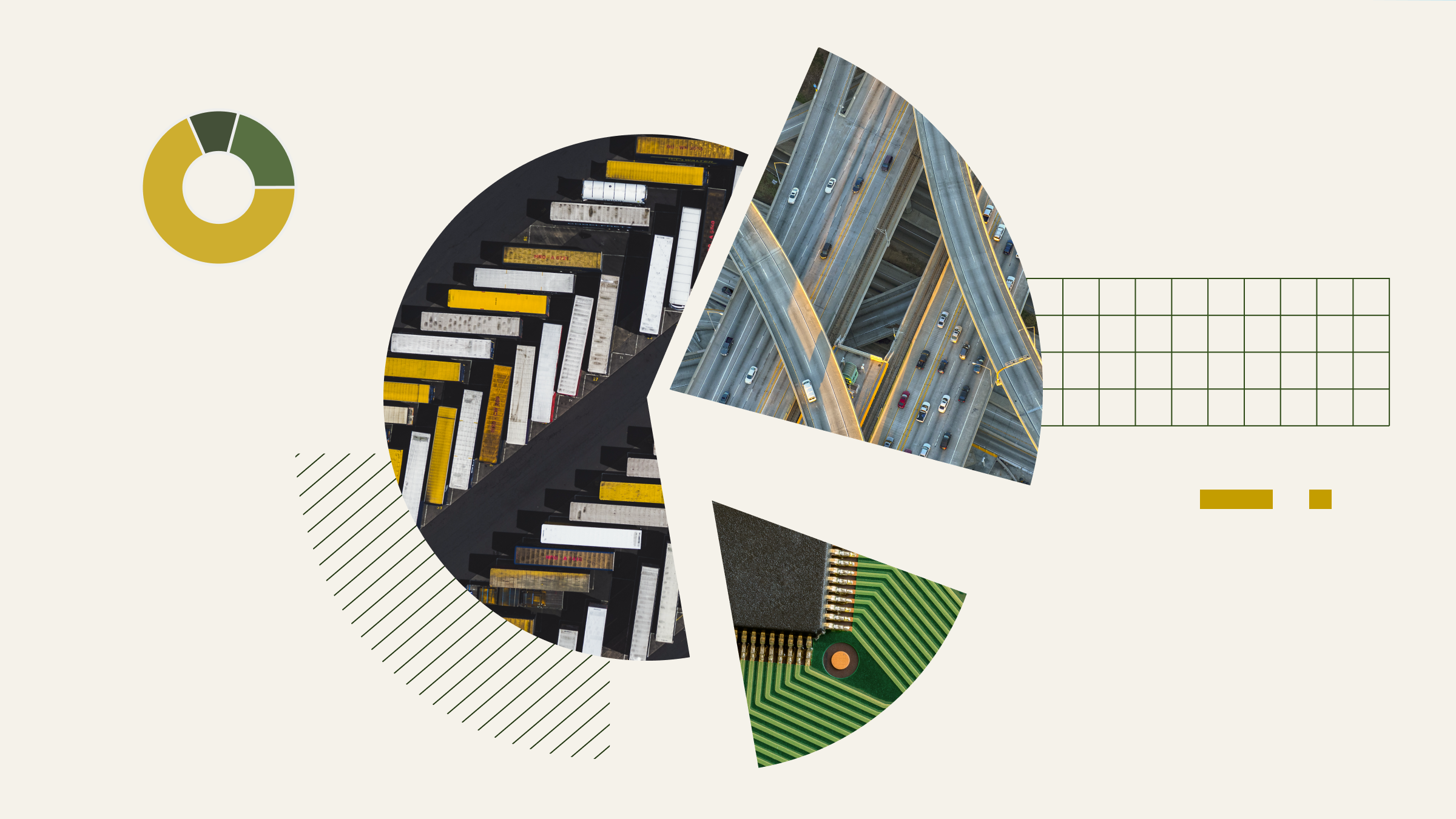Vor wenigen Wochen wurde eine in mehrfacher Hinsicht bemerkenswerte wissenschaftliche Studie veröffentlicht. Das Papier "Challenging the Conventional Wisdom on Active Management: A Review of the Past 20 Years of Academic Literature on Actively Managed Mutual Funds" von Martijn Cremers, Jon Fulkerson und Timothy Riley brach gleich zwei Rekorde: Es dürfte den längsten Titel aller Veröffentlichungen zu Investmentfonds tragen. Auch dürfte kein anderes Papier über Fonds eine derart umfassende Bibliographie aufweisen - 19 Seiten bei einem Umfang von insgesamt 41 Seiten!
Doch kommen wir zu der Studie selbst. Die Autoren wollen die These über die Überlegenheit von Indexfonds widerlegen. Doch bereits die Überschrift signalisiert, dass das Vorgehen nicht frei von Widersprüchen ist. Denn bei der Studie handelt sich um eine Literaturumschau, um eine Art Meta-Studie. Insofern ist mir nicht klar, wie man eine "konventionelle Weisheit" hinterfragen kann, indem man die gleichen Artikel zitiert, welche eben jene „konventionelle Weisheit“ geprägt haben.
Widerlegt eine Mainstream-Untersuchung die Mainstream-Meinung?
Meines Erachtens gelingt es den Autoren insgesamt nicht, die Mainstream-Schlussfolgerungen über aktives Management zu widerlegen. Es fängt damit an, dass sie die sichersten Schlussfolgerungen über den Erfolg von Index-Investments in Frage stellen. Dazu muss man wissen, dass die meisten Untersuchungen zu Fonds aus dem Universum der diversifizierten US-Aktienfonds stammen. Die Autoren zögern, die Ergebnisse für andere Fondsarten wie Anleihen, Immobilien, Allokation und internationale Aktien zu verallgemeinern, weil "es zu diesen Themen viel weniger Untersuchungen gegeben hat" und weil die vorhandenen Arbeiten (die sie angeben) dazu neigten, "veraltete Methoden zu verwenden".
Sie haben in einem Punkt Recht. US-Aktienfonds haben tatsächlich die meiste Aufmerksamkeit der Wissenschaft auf sich gezogen, weil sie am einfachsten zu untersuchen sind. US-Aktienfonds haben die längste Historie, verfügen eine begrenzte Anzahl von Holdings, und die Daten zu den Fonds und ihren Bestandteilen sind leicht verfügbar. Anders ist der Fall bei anderen Anlageklassen gelagert und auch bei Fonds außerhalb der USA und solche, die in anderen Regionen der Welt investieren – geschweige denn bei Mischfonds.
Doch sind durch diese typische Fokussierung auf US-Aktienfonds die Schlussfolgerungen zu Fonds aus anderen Asset Klassen und Regionen unzulässig? Das bezweifle ich. Die allermeisten Untersuchungen zu Nicht-US-Fonds, mögen sie auch nicht eine ähnliche lange Historie und inhaltliche Tiefe haben wie US-zentrierte Studien, zeigen, dass Indexierung zum Vorteil von Investoren wirkt. Auch wenn die Ergebnisse der Untersuchungen zu USA-Aktienfonds besonders stark für Indexfonds sprechen, so bleibt doch festzuhalten, dass es nicht reicht, Zweifel zu sähen. Der Ball liegt im Feld der Verfechter des aktiven Managements; sie müssen beweisen, wo aktives Management seine Chancen erfolgreich wahrnimmt.
Alpha geht nicht immer auf Managerfähigkeiten zurück
Die Stärken der Studie liegen in der Kritik am typischen Konzept von "Alpha", also Outperformance. Wie die Autoren betonen, wird der Begriff zwar häufig synonym für "Managerfähigkeit" verwendet, aber die Messung der Outperformance sei in den meisten nicht genau. Es werde erfasst, wann die risikoadjustierte Performance eines Fonds von der Benchmarks abweicht - ob das jedoch auf das Können des Managers, Glück oder auf eine nicht geeignete Benchmark zurückgeht, bleibe bei den meisten Untersuchungen offen.
Da ist etwas dran. Ein schmutziges kleines Geheimnis der Studien über Fonds ist, dass, egal wie sorgfältig man den Messprozess spezifiziert, dies nichts über die Frage aussagt, ob das Ergebnis aus Zufall oder Können resultiert. So kann jeder nicht standardisierte Indexfonds unter bestimmten Marktbedingungen ein Alpha erzeugen. Ein Indexfonds, der den gleichgewichteten S&P 500-Index abbildet, hat in der Vergangenheit sehr häufig ein "statistisch signifikantes" Alpha gegenüber dem (kapitalisierungsgewichteten) S&P 500 aufgewiesen.
Das Konzept des Anti-Survivorship Bias: Ein Muster ohne Nutzen
Die Autoren der Studie bringen zudem eine mir bis dato unbekannte Sichtweise ins Spiel: den Anti-Survivorship-Bias. Es ist allgemein anerkannt, dass Performance-Messungen von Fondsgruppen oder -kategorien, die nicht die liquidierten Produkte in Betracht ziehen, bessere Resultate hervorbringen als solche, welche die liquidierten Fonds miteinbeziehen. Ein Wissenschaftler hat dazu eine interessante Überlegung formuliert: Was wäre, wenn der Ausschluss von liquidierten Fonds die Ergebnisse der verbleibenden Fonds nach unten verzerre und nicht nach oben? Fondsgesellschaften würden Fonds zur Unzeit dichtmachen, weil sie ihnen nicht genug Zeit gäben, sich unter veränderten Marktbedingungen zu behaupten. Es spricht einiges für diese Sicht. Nicht nur Fondsinvestoren sind schlecht im Timing, sondern auch die Fondsgesellschaften. Die einen verkaufen, die anderen liquidieren Fonds zur Unzeit.
Nicht nur Fondsinvestoren sind schlecht im Timing, sondern auch die Fondsgesellschaften. Die einen verkaufen, die anderen liquidieren Fonds zur Unzeit.
Doch auch wenn diese Erkenntnis dafürspricht, die Fähigkeiten aktiver Manager höher einzuschätzen, als es typischerweise der Fall ist, so trägt sie nicht dazu bei, dass aktiv verwaltete Fonds eine überlegene Rendite für Investoren einspielen. Die verbesserte Performance wäre schließlich nur theoretisch möglich, also dann, wenn tote Fonds am Leben geblieben wären. Aber sie sind nun einmal nicht am Leben geblieben. Punkt.
Anleger sollten stärker bei aktiven Fonds diskriminieren
Die Autoren führen ins Feld, dass Anleger die Chance haben, ihre Ergebnisse zu verbessern, wenn sie nicht einfach irgendeinen Fonds kaufen. Sie könnten auf Fonds mit einer starken jüngeren Performance- Bilanz setzen, oder auf solche, die signifikant von ihren Indizes abweichen, also einen hohen aktive Share aufweisen. Oder in Fonds mit niedrigeren Transaktions-Quoten investieren. Und so weiter und so fort.
Es liegt mir fern, diesen Aufwand herunterzuspielen: Ich habe selbst einige solcher Artikel geschrieben und rate bei jeder Gelegenheit zu einer intensiven Fonds-Due Diligence. Es ist jedoch bedauerlich, dass die meisten von den Autoren aufgezeichneten Arbeiten dazu neigen, jeweils unterschiedliche Faktoren zu identifizieren. Das wirft die Möglichkeit des Data Mining auf – möglicherweise haben also die Schlussfolgerungen nur bei einer bestimmten Fondsauswahl in einer bestimmten Periode Gültigkeit, aber die Erkenntnisse wären nicht zu verallgemeinern.
Auch bringt die Identifikation von vorteilhaften Eigenschaften auf der Ebene einer Fonds-Gruppe Anlegern weniger Vorteile, als wenn man vorteilhafte Eigenschaften auf der Ebene von Aktien ausmachte. Man kann ohne weiteres eine Gruppe von Aktien kaufen (zumindest dann, wenn man ein institutioneller oder vermögender Investor ist), aber niemand wird jeden Fonds aus allen Kategorien kaufen, die bestimmte Eigenschaften aufweisen. Dieser Versuch wäre nicht praktikabel. Und selbst wenn die Wissenschaft so leistungsfähig wäre, einen persistenten Erfolgsfaktor auf Ebene einer Fondsgruppe zu identifizieren, so dürfte der Investor dennoch in der Praxis scheitern – sei es durch Pech, aufgrund der hohen Zahl an Fonds oder an den hohen Kosten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Untersuchung einen guten Überblick über die jüngste Literatur zu Investmentfonds bietet und gleichzeitig daran erinnert, dass Investoren in der Praxis beim Fondspicking oft zu grobschlächtig vorgehen. Es wäre tatsächlich sinnvoll, die Ergebnisse der Finanzforschung stärker zu in der Praxis zu reflektieren und punktuell zu berücksichtigen. Auch ist die Studie ein nützlicher Reminder, dass aktiv verwaltete Fonds nicht notwendigerweise minderwertig sind und dass sich eine intensive Due Diligence vor dem Fondskauf lohnt. Doch ich habe meine Zweifel, dass das Papier dazu angetan ist, viele Index-Fondsanleger zu Anhängern des aktiven Managements „umzupolen“.