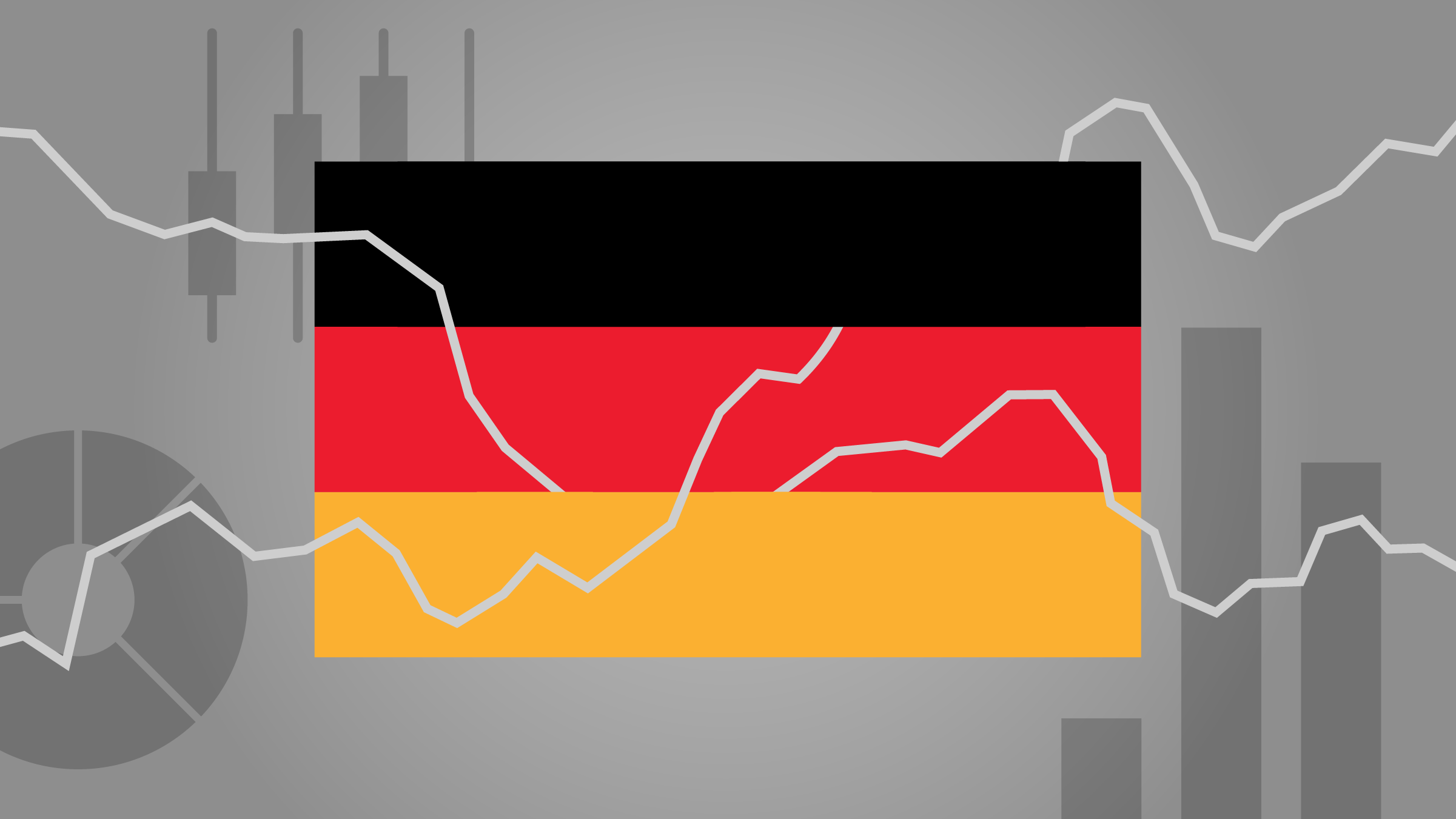Die Wirtschaft Deutschlands und der Eurozone stehen vor einem tiefen Einschnitt. Wie stark wird der Einbruch sein, und wann erfolgt der Aufstieg aus dem Konjunktur-Tal? Die Pandemie wird vielleicht nicht alles verändern, aber etlichen Branchen stehen tiefe Einschnitte bevor. Und wie steht es mit dem Verhältnis zwischen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsentwicklung? Wir haben bei Ulrich Kater von der DekaBank nachgefragt. Der promovierte Volkswirt war vor seiner Zeit bei der Sparkassenorganisation von 1995 bis 1999 im Stab der „fünf Wirtschaftsweisen“ für die Themen Geldpolitik und Kapitalmarkt verantwortlich. Seit 1999 ist Kater bei der DekaBank, seit 2004 in der Rolle als Chefvolkswirt.
Herr Dr. Kater, am 15. April haben sich die Bundesregierung und die Länder darauf geeinigt, die Wirtschaft behutsam, also schrittweise, wieder hochzufahren. Ist das, was beschlossen wurde, angetan, die Wirtschaft tatsächlich auf einen raschen Erholungspfad zu bringen?
In der Corona-Krise hat die Politik das Motto vorgegeben: Gesundheit geht vor. Die Virologen und die Volkswirte halten Daten, Analysen und Szenarien vor, aber es entscheidet die Politik, und das haben wir zu akzeptieren. Es gilt, die Pandemie einzudämmen, teilweise mit drastischen Maßnahmen. So, wie es heute aussieht, wird diese erste Phase der Krisenpolitik etwa sechs bis acht Wochen dauern. In der folgenden zweiten Phase wird es dann „nur noch“ darum gehen, die gedrückten Infektionszahlen beizubehalten und die Wirtschaft wieder hochzufahren. Zunächst wird das Korsett aber bestehen bleiben, auch wenn etliche Lockerungs-Maßnahmen getroffen werden.
Was kostet das an Wirtschaftswachstum?
Da gibt es unterschiedliche Schätzungen, die für Deutschland von einem Einbruch des Bruttoinlandsprodukts um zwischen drei und sieben Prozent ausgehen. Wir gehen von einem Minus von etwa fünf Prozent beim BIP für dieses Jahr aus, umgekehrt wird 2021 das Wachstum dann ebenfalls bei knapp fünf Prozent liegen. Der Einbruch wird in der Eurozone kräftiger als in Deutschland sein mit rund 5,5 Prozent; die Erholung wird 2021 mit knapp fünf Prozent nicht ganz so kräftig ausfallen.
Das würde ziemlich genau dem Muster der großen Finanzkrise entsprechen: Auf den Einbruch beim BIP von 5,7 Prozent im Jahr 2009 folgte eine Erholung von 4,2 Prozent 2010, also kein L, sondern eine v- oder u-förmige Erholung?
Ja, es wird ausgeprägte Nachholeffekte geben. Die Erholung wird in diesem Jahr einsetzen und bis ins nächste Jahr andauern: Wir verlieren fünf Prozent in diesem Jahr und legen im nächsten Jahr fast genauso viel zu. Aber da das BIP erst Ende 2021 dort stehen wird, wo es Anfang dieses Jahres schon mal war, würde ich die Konjunkturentwicklung eher als u-förmig bezeichnen.
Die Wirtschaft wird erst Ende 2021 dort stehen, wo sie Anfang dieses Jahres schon mal war, daher würde ich die Konjunkturentwicklung eher als u-förmig bezeichnen
Ist ein derart lineares Erholungsszenario wirklich realistisch? Es wird aller Voraussicht nach bis weit ins nächste Jahr keinen Impfschutz gegen das Corona-Virus geben.
Im Einzelnen wird das – je nach Branche – natürlich nicht linear sein, auch weil die deutsche Wirtschaft ja hochgradig international verflochten ist und man nie weiß, wie sich die Situation in den Nachbarländern entwickeln wird. Aber nach unserem Basisszenario wird die Erholung in diesem Jahr deutlich an Fahrt gewinnen. Ab Mai wird die Produktion wieder anlaufen, auch unter Corona-Bedingungen. Das Wiederhochfahren wird einem Puzzle-Spiel ähneln – Werkhallen müssen umgebaut, Lieferketten wiederhergestellt werden, und die Grenzen müssen in Europa geöffnet werden. Aber Menschen sind adaptionsfähig; Ende dieses Jahres dürften wir die Produktionslücke um mehr als 90 Prozent geschlossen haben.
Aber nicht alle Branchen werden zur Vor-Corona-Zeit zurückkehren können.
Nein, manche Branchen sind für eine vollständige Erholung darauf angewiesen, dass das Virus komplett verschwindet, etwa der Tourismus, und da vor allem Bereiche wie die Kreuzfahrt. Das wird, sofern es überhaupt passiert, auch Ende 2021 längst nicht so weit sein. Bei der Luftfahrt wird es sogar bleibende Schäden geben, unabhängig von der Frage, wie der Kampf gegen das Corona-Virus ausgeht. Die Pandemie hat einen Turboeffekt bei der Digitalisierung des Geschäftslebens bewirkt, elektronische Besprechungsformate haben sich schon heute etabliert, und es wird immer mehr zur Selbstverständlichkeit, Geschäftstreffen als Video-Konferenzen abzuhalten. Das wird auf Kosten der Business-Reisebranche gehen, auch langfristig.
Sie haben die Nachfrageseite bereits angesprochen, die sich nicht so leicht wieder hochfahren lässt wie die Produktion. Wie sieht es hier mit der Visibilität der Erholung aus?
Das ist eine spannende Frage. Es wird sich erst auf den letzten Metern, also im nächsten Jahr, entscheiden, ob sich die Nachfrage vollständig erholt oder ob sich nicht etwas strukturell verändert hat und weitergehende Maßnahmen nötig sind. Aktuell wird der Nachfrageschock durch das Schwächeln der Angebotsseite etwas abgemildert. Die Leute kaufen weniger ein, weil sie physisch dazu schlicht nicht in der Lage sind. Inwieweit werden sie sich auch im nächsten Jahr zurückhalten, etwa weil sie verunsichert, die Arbeitslosigkeit hoch ist, oder das Wohlstandsniveau insgesamt gesunken ist? Meine These lautet, dass sich die Erholung der Nachfrage und des Angebots insgesamt parallel entwickeln werden.
Aber wenn es doch nicht so kommt, dann dürften weitergehende fiskalische Stimuli anstehen, und es gibt ja auch eine Debatte um das so genannte Helikoptergeld. Wenn jeder von uns 1.000 Euro in die Hand bekäme, dürfte das den Konsum am ehesten ankurbeln.
Diese Debatte ist verfrüht, denn die Menschen haben derzeit nicht die Gelegenheit, zu konsumieren. Jetzt geht es erst einmal darum, die Wirtschaft wieder in Gang zu setzen und zu schauen, was passiert. Aber derartige Stützungs-Szenarien werden schon in den Regierungen in China und Europa für den Fall durchgespielt, dass die Nachfrageseite einen bleibenden Schaden nehmen könnte. Dass es in dem Fall weitere Impulse braucht, dürfte den Verantwortlichen klar sein. Die könnten die Gestalt von Konsumgutscheinen oder Steuererleichterungen haben, denkbar sind auch Investitionsanreize für die Industrie. Ich persönlich glaube, dass weitere Maßnahmen zur Konjunktur-Stimulierung nötig sein werden, da wird etwas kommen.
Wir es bei Steuerschecks bleiben? Oder doch Helikoptergeld von den Notenbanken? Oder vielleicht beides?
Helikoptergeld ist ein großes Wort. Wir sehen gerade eine Zerfaserung dieses Begriffs bzw. eine Vermengung verschiedener Interventionsszenarien. Konzeptionell, aus makro-ökonomischer Sicht, sind das geldpolitische Helikoptergeld und fiskalpolitische Maßnahmen strikt getrennt. Den Begriff Helikoptergeld hat Milton Friedman bereits Ende der 1960-er Jahre geprägt. Das Konzept sieht vor, dass die Zentralbank Geld schafft und es direkt an die Haushalte durchleitet. Heute verschwimmt der Begriff, und gelegentlich werden auch Steuererleichterungen als Helikoptergeld bezeichnet. Aber für Makroökonomen ist die Unterscheidung zwischen direkter Notenbank-Finanzierung der Haushalte und fiskalpolitischen Maßnahmen, wie Steuerschecks oder Direktüberweisungen vom Fiskus, wie etwa jüngst in Hongkong gemacht, von entscheidender Bedeutung. Helikoptergeld auszugeben wäre gleichbedeutend mit der Überschreitung des geldpolitischen Rubikons, das hat noch keine Zentralbank gemacht. Kommen wir tatsächlich an diesen Punkt? Meiner Meinung sind wir gerade im Begriff, uns an ihn heranzurobben.
Wir sind gerade im Begriff, uns an das Thema Helikoptergeld heranzurobben. Damit wäre der geldpolitische Rubikon überschritten
Es wurde schon darüber diskutiert, gemeinschaftliche Anleihen zur Beseitigung der Schäden des Corona-Virus zu begeben, welche die Europäische Zentralbank aufkauft. Das wäre eine fast schon naheliegende Vermengung von Fiskal- und Geldpolitik.
Wenn sich der Staat oder die EU, salopp gesagt, entschließt, ein Anleihe-Programm aufzulegen, um Geld zu verteilen und die EZB parallel ein Programm verabschiedet, das den Ankauf dieser Anleihen vorsieht, dann ist das genau die Aufweichung der Grenze zwischen Fiskal- und Geldpolitik, die ich eben angesprochen habe. Das ist allerdings nicht nur eine makroökonomische Debatte, sondern auch eine juristische Frage. Das Bundesverfassungsgericht wird am 5. Mai über eine weitere Verfassungsbeschwerde gegen das Anleihenkaufprogramm der EZB entscheiden. Es gab zwar schon einige, aber es könnte dieses Mal einen Paukenschlag geben, und es ist denkbar, dass das Gericht eine Grenze zieht und sagt: Bis hierher und nicht weiter. Ich bin gespannt, wie die Entscheidung lauten wird.
Inwiefern ist die Gefahr gegeben, dass vor dem Hintergrund der einbrechenden Konjunktur ein Disconnect, also eine Abkoppelung der Finanzmärkte von der Realwirtschaft, stattfindet? Die Aktienmärkte haben sich seit der Verkündung der fiskal- und geldpolitischen Stützungsmaßnahmen deutlich von ihren März-Tiefstständen erholt.
Man könnte einen Schritt weitergehen und fragen, ob dieser Disconnect zwischen der Realwirtschaft und den Finanzmärkten nicht bereits vorhanden ist und lediglich noch deutlich größer zu werden droht. Die aktuelle Krise hat den Trend zur höheren Verschuldung beschleunigt. Seit der Finanzkrise 2008 ist die weltweite Verschuldung der Unternehmen, der privaten Haushalte und der Staaten in Relation zum Welt-BIP um 40 Punkte von 280 auf 320 Prozent gestiegen. Das wird durch die Coronakrise noch weitergedreht, und die Bewertungen von Risiko-Assets werden entsprechend weiter steigen. Das muss aber nicht eine höhere Inflation zur Folge haben. Der Demographie-Effekt führt etwa dazu, dass private Haushalte mehr sparen und das Geld nicht in den Wirtschaftskreislauf zurückgegeben wird. Eine hohe Sparquote ohne Inflation war bisher ein Zeichen unserer Zeit, und das muss sich nicht ändern.
Hat die Aufblähung der Asset-Preise nicht gravierende gesellschaftliche Folgen? Es sind die Reichen, die am Kapitalmarkt investieren; sie sind die Profiteure von spekulativen Blasen. Die unteren Einkommens- und Vermögens-Dezile in der Bevölkerung investieren typischerweise nicht am Kapitalmarkt. Die Ungleichheiten werden also weiter zunehmen.
Es wurden zwar bei der Einkommensverteilung in den vergangenen Jahren deutliche Fortschritte gemacht; die unteren Einkommensschichten haben weltweit gesehen aufgeholt. Beim Vermögen ist das aber anders, da sehen wir immer größere Unterschiede, und die werden natürlich durch die lockere Geldpolitik weiter verschärft. Die Verantwortlichen in den Notenbanken würden zugestehen, dass diese Ungleichheit eine unerwünschte Nebenwirkung ihrer Geldpolitik ist. Aber sie würden auch argumentieren, dass die positiven Effekte, etwa die Erhöhung der Einkommen und die Aufrechterhaltung des Wirtschaftskreislaufs, wichtiger sind als die daraus resultierende Vermögensungleichheit. Die Frage, wie viel Ungleichheit wir bei der Vermögensverteilung bereit sind in Kauf zu nehmen, muss meiner Meinung nach in einem gesellschaftlichen Diskurs geklärt werden.
Die Fragen stellte Ali Masarwah
Verpassen Sie nichts! Alle Morningstar Analysen können Sie in unseren wöchentlichen Newslettern gratis mitbekommen. Hier anmelden und immer auf dem Laufenden bleiben!